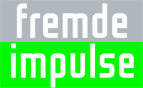Gartenkunst
Auf dem Gelände des Botanischen Gartens der Ruhr-Universität Bochum befindet sich der Chinesische Garten, der in dern 1990er Jahren vom Architekten Zhang Zhen geplant und von chinesischen Gärtnern angelegt wurde.
© Foto Dietrich Hackenberg
Kunst zurück zur Auswahl
Impulse für die Gartenkunst in Westfalen und im Ruhrgebiet
Die historischen Gärten im heutigen Ruhrgebiet entstanden einerseits im 17. und 18 Jh. im
Zusammenhang mit Klöstern und Adelssitzen, doch gibt es auch bedeutende Gartenschöpfungen, die im Zuge der mit der Industrialisierung einhergehenden städtebaulichen Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert angelegt wurden wie öffentliche Parks, Stadtplätze, Villengärten, Arbeiterkolonien und Hausgärten.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg entstandene herrschaftliche Gärten fanden zumeist Vorbilder in den barocken Anlagen Frankreichs, Anregungen aus der italienischen Gartenkunst wurden gern aufgenommen und mit eigenen Vorstellungen verbunden. Auch Einflüsse aus den wirtschaftlich prosperierenden Niederlanden haben ihre Spuren in westfälischen Gärten hinterlassen.
Der Abt Franziskus Daniels, der Kloster Kamp den Charakter einer fürstlichen Residenz gab, beauftragte den Mönch Benediktus Bücken mit der 1741 abgeschlossenen Umgestaltung der klösterlichen Gärten. Brücken hatte Mathematik und Baukunst studiert und entwarf den Garten „nach italienischen Mustern“ wie im Jahre 1802 der Pfarrer Michels schrieb. Der über eine Treppe erschlossene Terrassengarten war reich mit Skulpturen ausgestattet, von denen allerdings nur noch eine erhalten ist. Nach der Säkularisierung 1802 verfiel die barocke Anlage. Ab 1987 begann man mit dem Wiederaufbau des Gartens in Form einer zeitgenössischen Interpretation des barocken Geländeprofils. Bei dem heute vorhandenen Garten handelt es sich deshalb um einen vollständigen Neubau, dessen Gliederung dem historischen Vorbild nahe kommt. 1990 wurde der Terrassengarten vom Kloster Kamp wiedereröffnet.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich auch in Westfalen und im Ruhrgebiet die Abkehr vom formalen Garten französischen Vorbilds durch. Erste Landschaftsgärten, die ihren Ursprung im England des frühen 18. Jahrhunderts hatten, entstanden, einer der frühesten dürfte der um 1775 begonnene Bagno im westfälischen Steinfurt gewesen sein. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels veränderten sich landschaftlich angelegte Parks vom Abbild idealisierter Natur für Wenige zu Anlagen, die öffentlich zugänglich und nutzbar waren.
Der Gethmann’sche Garten in Hattingens Stadtteil Blankenstein, ab 1808 vom Kommerzienrat Carl Friedrich Gethmann (1777-1865) “zur Freude und Erholung seiner Mitbürger und aller Besucher des Städtchens Blankenstein angelegt“, war wohl ab 1834 öffentlich zugänglich. Das in wesentlichen Teilen in den 1830er Jahren gestaltete Areal an einem Nordhang über der Ruhr wurde mit geschwungenen Wegen, Aussichtshügeln, Sitzplätzen, einer Grotte und einem Belvedere ausgestattet. Bewusst geschaffene Ausblicke ins Ruhrtal und auf die Ruine Blankenstein sind Ausdruck einer spätlandschaftlichen, Auffassung von Landesverschönerung. Noch heute vermittelt der als Gartendenkmal geschützte Gethmann’sche Landschaftsgarten durch seine Gestaltung und Bepflanzung das romantisch verklärte Naturempfinden, Landschafts- und Lebensgefühl großbürgerlicher Schichten im 19. Jahrhundert.
Ein ganz anderer Impuls innerhalb der Gartenarchitektur manifestiert sich in dem Chinesischen Garten auf dem Gelände des ab 1966 angelegten Botanischen Gartens der Ruhr-Universität Bochum. Dort wurde in den 1990er Jahren der Chinesische Garten als Zeichen der Partnerschaft zwischen den Universitäten von Schanghai und Bochum von dem chinesischen Architekten Zhang Zhen geplant und von chinesischen Gärtnern errichtet. Architektur und Freiraum verbinden sich im Chinesischen Garten zu einer harmonischen Einheit. Im Frühjahr 2001 wurde der Chinesische Garten restauriert und im Herbst desselben Jahres wiedereröffnet. Einflüsse fernöstliche Gartenkunst sind allerdings keine „neue“ Erscheinung. Bereits in den Barockgärten von Versailles und in Landschaftsgärten wurden chinesisch anmutende Gebäude oder Landschaften nachgebildet. Und in den 1950er und 1960er Jahren war neben skandinavischen Einflüssen besonders die japanische Gartenarchitektur eine wichtige Inspirationsquelle zeitgenössisch moderner Freiraumgestaltung.
Denkmale zum Impuls
Bochum - Chinesischer Garten der Ruhr-Universität
Die Ursprünge chinesischer Gartenkunst gehen auf die chinesische Sagenwelt zurück. Um ... weiter
Kamp-Lindfort - Der Terrassengarten von Kloster Kamp
1802 schreibt Pfarrer Michels, dass der Mönch Benediktus Bücken den Garten von Kloster ... weiter