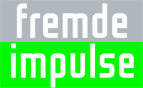Landsynagoge und Friedhof zwischen Selm und Bork
Synagogenweg / Kreisstraße • 59379 Selm-Bork
Das Synagogengebäude ist ein zweigeschossiges Fachwerkhaus mit Walmdach. Der vordere Bauteil des Gebäudes beinhaltet einen eingeschossigen Betsaal mit Frauenempore. An der östlichen Traufwand hat sich einst der Thoraschrein befunden.
© Dietrich Hackenberg
Glaube zurück zur Auswahl
Juden zwischen Stadt und Land
Für die 1820er Jahren sind acht jüdische Familien in Bork nachweisbar, zwischen 1821 und 1899 ist eine jüdische Schule belegt. Schon ab 1818 entstand an der alten Hauptstraße, heute Synagogenweg, eine kleine Synagoge. Es handelt sich um ein zweigeschossiges Fachwerkhaus mit Walmdach. 1938, nachdem das Gebäude in der Reichspogromnacht verwüstet worden war, wurde die Gemeinde enteignet und musste die Synagoge verkaufen. In den folgenden Jahren wurde es von dem neuen Besitzer als Heizöl- und Kohlelager genutzt.
1994 wurde die ehemalige Synagoge als »Kulturstätte mit erinnerndem und mahnendem Charakter« eingeweiht. Heute finden dort wieder regelmäßig jüdische Gottesdienste statt.
Der vordere Bauteil des Gebäudes beinhaltet einen eingeschossigen Betsaal mit Frauenempore. Dieser Raum wird durch zwei große Rundbogenfenster architektonisch hervorgehoben. An der östlichen Traufwand hat sich einst der Thoraschrein befunden, Konturen der Anbringung sind noch erhalten. Die aufwändige Schablonenmalerei der Wände ist restauriert worden und man erkennt an den oberen Wandbereichen eine florale Rankenbemalung. Die Decke zeigt eine blaue Bemalung, die den Hintergrund für einen in Gold gehaltenen Sternenhimmel bildet. Im hinteren, zweigeschossigen Gebäudeteil befanden sich ein Schulraum und Wohnräume. Beide Gebäudeteile sind getrennt voneinander durch eigene Eingänge zu betreten. Zur Frauenempore gelangt man nur über den hinteren, zweigeschossigen Gebäudeteil, sodass Frauen und Männer das Gebäude getrennt betreten.
Zu der Landsynagoge in Bork gehört auch ein jüdischer Friedhof, der außerhalb der Ortschaft an der Kreisstraße zwischen Selm und Bork liegt. 38 Grabsteine stehen auf dem umzäunten Gelände. »Hier ist begraben/eine gerechte Frau/bescheiden im Gespräch/ihre Taten waren schön.« So lautet die hebräische Inschrift auf dem ältesten Grabstein des Friedhofs. Sara Melchior starb 1835, sie war die Witwe eines der ersten Juden in Bork. Nach 1945 war der Friedhof völlig verwüstet und obwohl bereits im Juli 1945 der Befehl erteilt wurde, den Friedhof wieder herzustellen, geschah dies nur schleppend. 1959 war er immer noch in verwahrlostem Zustand und selbst 2002 waren noch einige Stelen umgeworfen.
Die jüdischen Friedhöfe machen neben der jahrhundertlangen Verwurzelung jüdischer Bürger in Deutschland auch die Schrecken der Schoa deutlich, die durch zerschlagene und zerkratzte Steine, fehlende Inschriften, wiederverwertete schmiedeeiserne Grabeinfassungen, aber auch durch teils schon früh gesetzte Mahnmale stets präsent sind. Insgesamt sind in Nordrheinwestfalen 474 noch bestehende jüdische Friedhöfe und 134 weitere Anlagen, die nicht mehr als Friedhöfe genutzt werden oder zu erkennen sind, dokumentiert.