Zeitabschnitte > Urgeschichte

Kai Niederhöfer
Urgeschichte Westfalens
 1. Die ersten Westfalen - das Paläolithikum (Altsteinzeit, ca. 600.000-10.000 v. Chr.)
1. Die ersten Westfalen - das Paläolithikum (Altsteinzeit, ca. 600.000-10.000 v. Chr.) 2. Nach der Eiszeit - das Mesolithikum (mittlere Steinzeit, ca. 10.000-5600 v. Chr.)
2. Nach der Eiszeit - das Mesolithikum (mittlere Steinzeit, ca. 10.000-5600 v. Chr.) 3. Westfalen werden sesshaft - das Neolithikum (Jungsteinzeit, ca. 5600-1900 v. Chr.)
3. Westfalen werden sesshaft - das Neolithikum (Jungsteinzeit, ca. 5600-1900 v. Chr.) 4. Wo ist das Metall? - Bronzezeit (ca. 1900-750 v. Chr.)
4. Wo ist das Metall? - Bronzezeit (ca. 1900-750 v. Chr.) 5. Bevor die Römer kamen - Vorrömische Eisenzeit (ca. 750 bis 12 v. Chr.)
5. Bevor die Römer kamen - Vorrömische Eisenzeit (ca. 750 bis 12 v. Chr.) 6. Literatur |
6. Literatur |  6.1 Allgemeine Geschichte |
6.1 Allgemeine Geschichte |
 6.2 Westfälische Geschichte |
6.2 Westfälische Geschichte |
6.3 Führer zu archäologischen Geländedenkmälern 7. Links
7. Links
Der urgeschichtliche Abschnitt der Menschheitsgeschichte umfasst den Zeitraum von der Altsteinzeit bis zur vorrömischen Eisenzeit. In Westfalen finden sich urgeschichtliche menschliche Relikte aus einem Zeitraum von fast 300.000 Jahren. Damit unterscheidet sich der hier zu behandelnde Abschnitt der westfälischen Geschichte von allen späteren vor allem durch zwei Aspekte: Es ist der längste, der hier zusammenhängend betrachtet wird, und zugleich der einzige Abschnitt, über den keine Schriftquellen Auskunft geben. Die Quellen der Urgeschichte sind ausnahmslos archäologische Hinterlassenschaften, die je nach Erhaltungszustand nur ein recht lückenhaftes Bild ergeben.
1. Die ersten Westfalen - das Paläolithikum
(Altsteinzeit, ca. 600.000-10.000 v. Chr.)
Vor etwa 600.000 Jahren besiedelte der Mensch Mitteleuropa. Einer der berühmtesten Funde dieser Zeit ist ein bereits im Jahre 1907 in Mauer bei Heidelberg entdeckter Schädel eines urgeschichtlichen Menschen, des sog. Homo heidelbergensis. Die frühesten menschlichen Relikte aus Westfalen sind allerdings jünger, sie stammen aus dem Mittelpaläolithikum, dem mittleren Abschnitt der Altsteinzeit. Als vor etwa 250.000 Jahren die vorletzte große Vereisung, die Saale-Kaltzeit, ihre maximale Südausdehnung erreicht hatte, waren weite Teile Westfalens bis zur Ruhr vom Inlandeis bedeckt. Funde aus der Zeit vor dieser Vereisung sind aus Westfalen nicht bekannt, wohl aber aus angrenzenden Regionen (Hessen, Rheinland), sodass anzunehmen ist, dass in den wärmeren Abschnitten des Eiszeitalters das gesamte nördliche Mitteleuropa bereits begangen wurde.
Als vor etwa 220.000 Jahren die Eismassen der Gletscher Mitteleuropa vorerst wieder verlassen hatten, finden sich in Westfalen nur spärliche Hinterlassenschaften des Menschen. Das charakteristischste und bekannteste Werkzeug des Mittelpaläolithikums ist der Faustkeil, der von den Menschen dieser Zeit, den Neandertalern vielseitig eingesetzt wurde. Der älteste direkte Beleg urgeschichtlicher Menschen in Westfalen ist ein Schädelfragment eines Neandertalers aus Warendorf. Vor rund 80.000 Jahren, während der letzten Eiszeit, der Weichsel-Kaltzeit, die vor rund 118.000 Jahren einsetzte, lebte dieser erste (bekannte) Westfale. Seine Lebensgrundlage war das Jagen und Sammeln. Seine Beute in den baumarmen Tundren- und Steppenlandschaften dieser Zeit war vorwiegend Großwild (Mammut, Wollnashorn, Ren und Pferd). Ergänzt und bei fehlendem Jagdglück sichergestellt wurde die Ernährung durch das Sammeln von Beeren, Nüssen und Wurzeln.
Vor etwa 35.000 Jahren, im Jungpaläolithikum, tritt in Mitteleuropa der anatomisch moderne Mensch, der Homo sapiens auf. Sein bisher ältester Nachweis in Westfalen, ein fast vollständig erhaltenes Schädeloberteil eines ca. 35-jährigen Mannes, stammt aus der Blätterhöhle bei Hagen, datiert allerdings erst in die frühe Mittelsteinzeit und ist rund 10.700 Jahre alt.
Neben den für den gesamten Zeitabschnitt namengebenden Steinwerkzeugen wurden auch Geräte aus Holz oder Knochen verwendet, die allerdings heute nur selten erhalten sind. Der jungpaläolithische Homo sapiens scheint sehr innovativ gewesen zu sein, er verbesserte die Zweckmäßigkeit der Waffen und Geräte erheblich und entwickelte u. a. Pfeil und Bogen, die Speerschleuder und die Harpune.
Zu dieser Zeit finden sich auch die ersten deutlichen Zeugnisse der "Geisteswelt" steinzeitlicher Menschen. Die "älteste Kunst der Welt" äußert sich u. a. in Form der berühmten Höhlenmalereien in den südfranzösischen und spanischen Bildhöhlen (z. B. Lascaux, Chauvet, Altamira). Vergleichbare Kunstwerke fehlen in Westfalen, lediglich ein Tonschiefergeröll aus der Balver Höhle (Märkischer Kreis) trägt die Gravierung eines Pferdekopfes. Vergleichbare Kleinkunst ist in Deutschland recht häufig (z. B. in Gönnersdorf und Andernach in der Mittelrheingegend), allerdings lässt sich für das Balver Stück die Echtheit nicht mehr sicherstellen.
Als vor etwa 220.000 Jahren die Eismassen der Gletscher Mitteleuropa vorerst wieder verlassen hatten, finden sich in Westfalen nur spärliche Hinterlassenschaften des Menschen. Das charakteristischste und bekannteste Werkzeug des Mittelpaläolithikums ist der Faustkeil, der von den Menschen dieser Zeit, den Neandertalern vielseitig eingesetzt wurde. Der älteste direkte Beleg urgeschichtlicher Menschen in Westfalen ist ein Schädelfragment eines Neandertalers aus Warendorf. Vor rund 80.000 Jahren, während der letzten Eiszeit, der Weichsel-Kaltzeit, die vor rund 118.000 Jahren einsetzte, lebte dieser erste (bekannte) Westfale. Seine Lebensgrundlage war das Jagen und Sammeln. Seine Beute in den baumarmen Tundren- und Steppenlandschaften dieser Zeit war vorwiegend Großwild (Mammut, Wollnashorn, Ren und Pferd). Ergänzt und bei fehlendem Jagdglück sichergestellt wurde die Ernährung durch das Sammeln von Beeren, Nüssen und Wurzeln.
Vor etwa 35.000 Jahren, im Jungpaläolithikum, tritt in Mitteleuropa der anatomisch moderne Mensch, der Homo sapiens auf. Sein bisher ältester Nachweis in Westfalen, ein fast vollständig erhaltenes Schädeloberteil eines ca. 35-jährigen Mannes, stammt aus der Blätterhöhle bei Hagen, datiert allerdings erst in die frühe Mittelsteinzeit und ist rund 10.700 Jahre alt.
Neben den für den gesamten Zeitabschnitt namengebenden Steinwerkzeugen wurden auch Geräte aus Holz oder Knochen verwendet, die allerdings heute nur selten erhalten sind. Der jungpaläolithische Homo sapiens scheint sehr innovativ gewesen zu sein, er verbesserte die Zweckmäßigkeit der Waffen und Geräte erheblich und entwickelte u. a. Pfeil und Bogen, die Speerschleuder und die Harpune.
Zu dieser Zeit finden sich auch die ersten deutlichen Zeugnisse der "Geisteswelt" steinzeitlicher Menschen. Die "älteste Kunst der Welt" äußert sich u. a. in Form der berühmten Höhlenmalereien in den südfranzösischen und spanischen Bildhöhlen (z. B. Lascaux, Chauvet, Altamira). Vergleichbare Kunstwerke fehlen in Westfalen, lediglich ein Tonschiefergeröll aus der Balver Höhle (Märkischer Kreis) trägt die Gravierung eines Pferdekopfes. Vergleichbare Kleinkunst ist in Deutschland recht häufig (z. B. in Gönnersdorf und Andernach in der Mittelrheingegend), allerdings lässt sich für das Balver Stück die Echtheit nicht mehr sicherstellen.

Mittelpaläolithische Steingeräte aus Bielefeld-Johannistal

Mittelpaläolitischer Faustkeil aus Rhede/Kreis Borken

Schädelfragment eines Neandertalers aus Warendorf
Bild- und Textmaterialien für den Schulunterricht bietet das Themenheft
 "Werkzeugherstellung in der Steinzeit" (2. Aufl. 1988) von Renate Wiechers-Weidner
"Werkzeugherstellung in der Steinzeit" (2. Aufl. 1988) von Renate Wiechers-Weidner2. Nach der Eiszeit - das Mesolithikum
(mittlere Steinzeit, ca. 10.000-5600 v. Chr.)
Durch einen grundlegenden Klimawandel mit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 11.700 Jahren stand der Mensch einer drastisch veränderten Umwelt gegenüber. Innerhalb kurzer Zeit stieg die Durchschnittstemperatur rapide an, das Holozän, die heutige Warmzeit begann. Mit der Erwärmung ging eine rasche Ausbreitung des Waldes einher, aus geschmolzenen Gletschern entstanden Flüsse und Seen. Kälteangepasste Pflanzenfresser, wie z. B. das Mammut und die an die Grassteppen angepassten Herden der Rentiere und Wildpferde zogen nach Norden.
Der Mensch passte seine Jagdmethoden den neuen Umweltbedingungen an. Ganz Westfalen gehörte zu dieser Zeit zum Streifgebiet mesolithischer Jäger, die im jahreszeitlichen Rhythmus die Region durchzogen. Neue Beutetiere, Waldtiere wie Hirsch, Reh und Auerochse, erforderten neue Jagdmethoden: Pfeil und Bogen sowie Fischfanggeräte wurden unentbehrlich. Im Fundmaterial dieser Zeit schlägt sich dieser Umstand vor allem in kleinen geometrischen Flintspitzen, den sog. Mikrolithen nieder, die mit Birkenpech an Pfeilspitzen oder Harpunen befestigt wurden. An einigen mesolithischen Fundplätzen haben sich neben Mikrolithen auch Feuerstellen und Grundrisse hüttenartiger Behausungen erhalten (Rethlager Quellen, Kreis Lippe). An einem noch ungestörten Siedlungsplatz in Oelde-Weitkamp (Kreis Soest) lag um eine Feuerstelle eine Konzentration solcher Mikrolithen, daneben Knochensplitter der Jagdbeute (Rothirsch, Reh, Wildschwein und Hase), Himbeerkerne und Schalen verkohlter Haselnüsse, die durch Rösten haltbar gemacht worden sind.
Der Mensch passte seine Jagdmethoden den neuen Umweltbedingungen an. Ganz Westfalen gehörte zu dieser Zeit zum Streifgebiet mesolithischer Jäger, die im jahreszeitlichen Rhythmus die Region durchzogen. Neue Beutetiere, Waldtiere wie Hirsch, Reh und Auerochse, erforderten neue Jagdmethoden: Pfeil und Bogen sowie Fischfanggeräte wurden unentbehrlich. Im Fundmaterial dieser Zeit schlägt sich dieser Umstand vor allem in kleinen geometrischen Flintspitzen, den sog. Mikrolithen nieder, die mit Birkenpech an Pfeilspitzen oder Harpunen befestigt wurden. An einigen mesolithischen Fundplätzen haben sich neben Mikrolithen auch Feuerstellen und Grundrisse hüttenartiger Behausungen erhalten (Rethlager Quellen, Kreis Lippe). An einem noch ungestörten Siedlungsplatz in Oelde-Weitkamp (Kreis Soest) lag um eine Feuerstelle eine Konzentration solcher Mikrolithen, daneben Knochensplitter der Jagdbeute (Rothirsch, Reh, Wildschwein und Hase), Himbeerkerne und Schalen verkohlter Haselnüsse, die durch Rösten haltbar gemacht worden sind.

Mikrolithen (Frühmesolithische Pfeilspitzen) vom Vorplatz der Blätterhöhle im weiteren Bereich einer Feuerstelle

Rekonstruktion der mittelsteinzeitlichen Hütten von den Rethlager Quellen im Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen
3. Westfalen werden sesshaft -
das Neolithikum (Jungsteinzeit,
ca. 5600-1900 v. Chr.)
Mit dem Übergang vom Dasein als Jäger und Sammler zur Sesshaftigkeit mit Ackerbau und/oder Viehzucht beginnt die Jungsteinzeit. Kulturell wie technologisch handelt es sich dabei um eine der größten Umwälzungen der Menschheitsgeschichte. Dieser Neolithisierungsprozess begann bereits um 12.000 v. Chr. im vorderen Orient und breitete sich über Südosteuropa und den Balkan bis nach Mitteleuropa aus.
Die älteste Ackerbau-Kultur Mitteleuropas, deren Spuren sich vor ca. 7.300 Jahren auch in Westfalen finden, ist die Linearbandkeramische Kultur (benannt nach ihrer typischen Gefäßverzierung). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Südrussland bis ins Pariser Becken. In Westfalen ist sie an die fruchtbaren Böden des Münsterlandes und der Hellwegzone gebunden. Die Menschen der Linearbandkeramik bauten die ersten festen Langhäuser in Westfalen. Zur gleichen Zeit findet sich auch sog. La Hougette-Keramik (benannt nach einem Fundort in Nordfrankreich). Es handelt sich um Hinterlassenschaften einer anderen frühneolithischen Tradition, die aus Südwesteuropa nach Westfalen gekommen ist. Siedlungsplätze dieser Kultur sind in Westfalen bislang nicht bekannt, ihre Träger waren vielleicht mobiler, noch einer mesolithischen Tradition verbunden und lebten außerhalb der Lössgebiete in den Mittelgebirgsregionen, wo die neolithische Lebensweise erst im Mittelneolithikum übernommen wird.
Das recht einheitliche frühneolithische Kulturbild Mitteleuropas zerfällt im Mittelneolithikum (4900-4400 v. Chr.) immer stärker in regionale Gruppen (in Westfalen vor allem die Rössener Kultur), die sich im Wesentlichen nur in ihren Keramikstilen unterscheiden, sodass es fraglich ist, ob es sich dabei tatsächlich um unterschiedliche ethnische Gruppen gehandelt hat. Schon zu dieser Zeit, vereinzelt auch früher, gab es bereits ausgeprägte Handelsbeziehungen, wie Funde von Feuersteingeräten aus der Maasregion und dem Raum Aachen, Hornsteingeräten aus Bayern oder Jadeitbeilen aus dem Westalpenraum zeigen.
Im Jungneolithikum (4400-3400 v. Chr.) hält im nördlichen Westfalen mit der Trichterbecherkultur (nach einer ihrer charakteristischen Keramikformen benannt) die Sitte Einzug, die Toten in Steinkammergräbern aus großen Findlingen, sog. Ganggräbern zu bestatten, die als Kollektivgräber über längere Zeit, vielleicht von einer Sippe oder einer kleinen Dorfgemeinschaft als Grabstätten genutzt wurden. Man hat in diesen Gräbern immer wieder Tote beigesetzt, ältere Bestattungen wurden einfach beiseite geschoben. Im südostwestfälisch-nordhessischen Raum finden sich Steinkisten- oder Galeriegräber der Wartbergkultur (nach einem Fundort in Hessen benannt), ebenfalls aus großen Steinen, aber in etwas anderer Bauweise aus behauenen Steinplatten errichtet. Ein Wandstein aus dem Galeriegrab Warburg I trägt eingravierte symbolische Zeichen, die als Rindergespanne mit Joch gedeutet werden. Sie werfen ein Schlaglicht auf die damaligen Jenseitsvorstellungen und den Totenkult.
Im Jungneolithikum finden sich in ganz Europa, so auch in Westfalen sog. Erdwerke, mehrteilige Wall-Graben-Anlagen, teils als geschlossene Ringwälle auf Plateaus, teils als Abschnittswälle auf Bergspornen. Die genaue Bedeutung dieser Anlagen ist z. T. unklar. Gegen Ende der Linearbandkeramischen Kultur vor etwa 7.000 Jahren häufen sich Erdwerke mit Siedlungsspuren im Innern, die mit einschneidenden Unruhen und kriegerischen Auseinandersetzungen in Verbindung zu stehen scheinen. Die jüngeren Erdwerke der Michelsberger Kultur (nach dem namengebenden Fundort in Baden-Württemberg benannt) enthalten dagegen kaum Hinweise auf Besiedlung. Aufgrund der häufigen Durchlässe werden es wohl keine Fortifikationen im engeren Sinne gewesen sein. Menschliche Skelettreste und z. T. vollständige Gefäße in den Gräben lassen an Opferhandlungen denken. Diese Erdwerke, wie immer sie im Einzelnen auch anzusprechen sind, sind ein Zeugnis für eine durchorganisierte, enorme kollektive Arbeitsleistung einer Gruppe zu dieser Zeit.
Die älteste Ackerbau-Kultur Mitteleuropas, deren Spuren sich vor ca. 7.300 Jahren auch in Westfalen finden, ist die Linearbandkeramische Kultur (benannt nach ihrer typischen Gefäßverzierung). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Südrussland bis ins Pariser Becken. In Westfalen ist sie an die fruchtbaren Böden des Münsterlandes und der Hellwegzone gebunden. Die Menschen der Linearbandkeramik bauten die ersten festen Langhäuser in Westfalen. Zur gleichen Zeit findet sich auch sog. La Hougette-Keramik (benannt nach einem Fundort in Nordfrankreich). Es handelt sich um Hinterlassenschaften einer anderen frühneolithischen Tradition, die aus Südwesteuropa nach Westfalen gekommen ist. Siedlungsplätze dieser Kultur sind in Westfalen bislang nicht bekannt, ihre Träger waren vielleicht mobiler, noch einer mesolithischen Tradition verbunden und lebten außerhalb der Lössgebiete in den Mittelgebirgsregionen, wo die neolithische Lebensweise erst im Mittelneolithikum übernommen wird.
Das recht einheitliche frühneolithische Kulturbild Mitteleuropas zerfällt im Mittelneolithikum (4900-4400 v. Chr.) immer stärker in regionale Gruppen (in Westfalen vor allem die Rössener Kultur), die sich im Wesentlichen nur in ihren Keramikstilen unterscheiden, sodass es fraglich ist, ob es sich dabei tatsächlich um unterschiedliche ethnische Gruppen gehandelt hat. Schon zu dieser Zeit, vereinzelt auch früher, gab es bereits ausgeprägte Handelsbeziehungen, wie Funde von Feuersteingeräten aus der Maasregion und dem Raum Aachen, Hornsteingeräten aus Bayern oder Jadeitbeilen aus dem Westalpenraum zeigen.
Im Jungneolithikum (4400-3400 v. Chr.) hält im nördlichen Westfalen mit der Trichterbecherkultur (nach einer ihrer charakteristischen Keramikformen benannt) die Sitte Einzug, die Toten in Steinkammergräbern aus großen Findlingen, sog. Ganggräbern zu bestatten, die als Kollektivgräber über längere Zeit, vielleicht von einer Sippe oder einer kleinen Dorfgemeinschaft als Grabstätten genutzt wurden. Man hat in diesen Gräbern immer wieder Tote beigesetzt, ältere Bestattungen wurden einfach beiseite geschoben. Im südostwestfälisch-nordhessischen Raum finden sich Steinkisten- oder Galeriegräber der Wartbergkultur (nach einem Fundort in Hessen benannt), ebenfalls aus großen Steinen, aber in etwas anderer Bauweise aus behauenen Steinplatten errichtet. Ein Wandstein aus dem Galeriegrab Warburg I trägt eingravierte symbolische Zeichen, die als Rindergespanne mit Joch gedeutet werden. Sie werfen ein Schlaglicht auf die damaligen Jenseitsvorstellungen und den Totenkult.
Im Jungneolithikum finden sich in ganz Europa, so auch in Westfalen sog. Erdwerke, mehrteilige Wall-Graben-Anlagen, teils als geschlossene Ringwälle auf Plateaus, teils als Abschnittswälle auf Bergspornen. Die genaue Bedeutung dieser Anlagen ist z. T. unklar. Gegen Ende der Linearbandkeramischen Kultur vor etwa 7.000 Jahren häufen sich Erdwerke mit Siedlungsspuren im Innern, die mit einschneidenden Unruhen und kriegerischen Auseinandersetzungen in Verbindung zu stehen scheinen. Die jüngeren Erdwerke der Michelsberger Kultur (nach dem namengebenden Fundort in Baden-Württemberg benannt) enthalten dagegen kaum Hinweise auf Besiedlung. Aufgrund der häufigen Durchlässe werden es wohl keine Fortifikationen im engeren Sinne gewesen sein. Menschliche Skelettreste und z. T. vollständige Gefäße in den Gräben lassen an Opferhandlungen denken. Diese Erdwerke, wie immer sie im Einzelnen auch anzusprechen sind, sind ein Zeugnis für eine durchorganisierte, enorme kollektive Arbeitsleistung einer Gruppe zu dieser Zeit.

Megalithgrab "Sloopsteene" bei Lotte-Wersen/Kreis Steinfurt, um 3000 v. Chr.

Modell des Galeriegrabs von Warburg/Kreis Höxter während des Baus

Wandstein mit stilisierten Bildzeichen (Ochsengespanne) aus dem Großsteingrab von Warburg/Kreis Höxter

Befestigungsgräben des jungneolithischen Erdwerks (Michelsberger Kultur, um 3500 v. Chr.) von Salzkotten-Oberntudorf, Luftbild
Bild- und Textmaterialien für den Schulunterricht bietet das Themenheft
 "Luftbildarchäologie in Westfalen" (1989)
"Luftbildarchäologie in Westfalen" (1989)4. Wo ist das Metall? -
Bronzezeit (ca. 1.900-750 v. Chr.)
Ab etwa 2200 v. Chr. lässt sich in Mitteleuropa der Beginn der Bronzezeit fassen. Es handelt sich dabei nicht um einen kulturellen Bruch, sondern vielmehr um eine fortlaufende Entwicklung, sind doch bereits seit dem jüngeren Neolithikum Gegenstände aus Kupfer bekannt, z. B. Schmuck in Form von kleinen Röhrchen, Drähten und Plättchen als Grabbeigaben. Der "Ötzi" (ca. 3200 v. Chr.) war ein "später Jungsteinzeitler", der bereits ein perfekt gearbeitetes Kupferbeil bei sich hatte. Die ersten Metallgegenstände kamen vermutlich aus Südosteuropa, wo die Metallnutzung bereits einige Jahrhunderte früher aufkam. Im Endneolithikum (2800-2200 v. Chr.) wurden in Mittel- und Nordeuropa Vorbilder aus Metall (Dolche u. Äxte) in Stein nachgeahmt. Man spricht mangels früher Metallfunde in Westfalen erst ab etwa 1900 v. Chr. von der Bronzezeit.
Lediglich aus der frühen Bronzezeit kennen wir repräsentative Siedlungsplätze in Westfalen. In Bocholt, Rhede (beide Kreis Borken) und Telgte (Kreis Warendorf) sind Grundrisse von rechteckigen Langhäusern mit Walmdächern und halbkreisförmigen Schmalseiten ergaben worden.
Die für diese Zeitperiode namengebenden Bronzefunde sind in Siedlungen äußerst selten. Lediglich aus der frühbronzezeitlichen Siedlung von Rhede ist eine Stabdolchklinge bekannt. Die Gründe für das weitgehende Fehlen liegen im Wert des Metalls. Die Rohstoffe der Bronzelegierung (90 % Kupfer, 10 % Zinn) kommen in Westfalen nicht natürlich vor und mussten importiert werden. Ihr Gegenwert musste in Naturalien erwirtschaftet werden. Die wenigen bekannten Siedlungen aus späteren Abschnitten der Bronzezeit sind ebenfalls frei von Bronzegegenständen. Aus den Siedlungsplätzen lassen sich weitere Aufschlüsse über die Umwelt des bronzezeitlichen Menschen gewinnen. Mangelernährung und geringe medizinische Kenntnisse führten u. a. zu einer hohen Kindersterblichkeit. Man bestattete die Kinder in der frühen Bronzezeit direkt in der Siedlung, nicht auf den zugehörigen Gräberfeldern, wie ein Kindergrab in zwei zusammengeschobenen Haushaltsgefäßen aus Ostbevern-Schirl/Kreis Warendorf zeigt.
Eine Besonderheit des frühbronzezeitlichen Siedlungswesens in Westfalen ist die Wallburg auf dem Schweinskopf bei Tecklenburg-Brochterbeck (Kreis Steinfurt). Im 17. Jh. v. Chr. errichtete man hier eine Befestigung auf einem Bergsporn, vermutlich um einen Passübergang des Teutoburger Waldes zu kontrollieren. Als bisher einzige bronzezeitliche Befestigung Westfalens ist sie Indikator für eine Machtkonzentration in der frühen Bronzezeit. Zur Errichtung einer solchen Anlage war ein funktionierendes Gemeinwesen mit hierarchischen Strukturen notwendig.
Die Hauptquellen für die Bronzezeit Westfalens sind aber nicht die Siedlungen, sondern die Grabfunde. In der frühen Bronzezeit wurden offenbar nur die Angehörigen einer Oberschicht individuell unter monumentalen Grabhügeln aus Steinen, Lehm oder Sand bestattet. Die Toten wurden in seitlicher Hockerlage niedergelegt, ohne Bronzegegenstände als Grabbeigaben, jedoch mit Äxten und Dolchen aus Stein, die häufig den Formen von Bronzegeräten nachempfunden waren.
Auch in der mittleren Bronzezeit bestattete man die Toten weiterhin unter Grabhügeln, nun allerdings in gestreckter Rückenlage und erstmals mit Beigaben aus Bronze, häufig Schwerter der Typen Sögel und Wohlde (nach einem niedersächsischen bzw. einem schleswig-holsteinischen Fundplatz benannt), kombiniert mit einer Lanze oder einem Beil. Der Grabbezirk wurde durch Pfostenkränze, Steinkreise oder ähnliches abgegrenzt. Die Verbreitung dieser Männergräber des sog. Sögel-Wohlde-Kreises beschränkt sich ebenso auf Ostwestfalen und Lippe, wie die etwas jüngeren, aber ebenfalls mittelbronzezeitlichen Frauenbestattungen mit Schmuckbeigaben, in der Regel sog. Doppelradnadeln. Als Besonderheit der mittleren Bronzezeit in Westfalen sind Brandbestattungen unter den Grabhügeln zu nennen, in denen z. T. sogar Holzsärge oder eigens aus Eichenbohlen gezimmerte "Totenhütten" mit verbrannt wurden (sog. Paderborner Gruppe). Dadurch setzen sie sich von der üblichen Bestattungsweise in Körpergräbern der Hügelgräberbronzezeit in umliegenden Nordhessen oder Niedersachsen (sog. Lüneburger Gruppe) deutlich ab.
Erst ab der jüngeren Bronzezeit finden sich größere Gräberfelder, auf denen die Toten dann grundsätzlich verbrannt bestattet wurden, so z. B. ab 1200 v. Chr. in Warendorf-Neuwarendorf, mit über 3.000 jungbronzezeitlichen Gräbern. Der Leichenbrand (ca. 1,6-2,0 kg bei einem Erwachsenen) wurde sorgsam aus der Asche ausgelesen, gewaschen und in einem Tongefäß als Urne (Urnengrab) oder einem Beutel oder Tuch (sog. Leichenbrandnest, da sich in der Regel nur die Knochen erhalten haben) beigesetzt. Zusätzlich wurden die Urnen häufig mit einem Stein oder einer umgedrehten Schale abgedeckt und mit Grabbeigaben (ein oder zwei Gefäße mit Speisebeigaben, bronzene Pinzetten und sog. Rasiermesser) ausgestattet. Die Gräber wurden äußerlich durch Hügel, umgeben von Kreis- oder Schlüssellochgräben kenntlich gemacht. Letztere sind gerade für Westfalen und das südwestliche Niedersachsen (sog. Ems-Gruppe) charakteristisch.
Eine außergewöhnliche Grabbeigabe stammt aus einem Kindergrab in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh). Es handelt sich um ein verziertes Bronzebecken, das vermutlich aus Sachsen-Anhalt importiert wurde. Diese Kostbarkeit zeigt sicher ebenso die Zugehörigkeit zu einer Oberschicht an, wie eine reich verzierte Bronzesitula aus Gevelinghausen (Hochsauerlandkreis) aus dem 8. Jh. v. Chr., die als Urne diente. Das Gefäß, das mit seiner Symbolik (sog. Vogel-Sonnen-Barke) in den kultischen Bereich gehört, ist durch Abbrechen eines Henkels "entweiht" worden, um es als Urne verwenden zu können. Ähnliches lässt sich bei anderen Gefäßen dieser Art in ganz Mitteleuropa beobachten, von denen das Gevelinghausener das schönste und besterhaltenste ist.
Weitere Metallfunde stammen in Westfalen neben den Grabfunden in erster Linie aus Horten. Einzelne Beile oder Äxte könnten auch einfach verloren gegangen sein, Deponierungen mit zwei oder mehreren Stücken dienten aber sicher entweder als Rohstoff- oder Warenlager, Schatzversteck oder aber als Opfergabe. Sind die Stück allesamt fragmentiert oder beschädigt, handelt es sich vermutlich um ein Altmetalllager. Komplett erhaltene und hochwertige Stücke kommen für einen persönlichen Schatz, Handelsware oder Opfer in Frage, letzteres vor allem, wenn die Stücke in einem Gewässer oder Moor deponiert wurden. Ein großer Teil bronzezeitlicher Deponierungen entzieht sich einer sicheren Deutung, allerdings fällt auf, dass es sich häufig um "erlesene" Stücke handelte, die importiert werden mussten. So wird vor allem an den Hortfunden deutlich, dass man in Westfalen wirtschaftlich in der Lage war, sich diese Gegenstände trotz des Rohstoffmangels zu besorgen. Wogegen diese Rohstoffe getauscht wurden, lässt sich im Einzelnen kaum erschließen. Lediglich ein Handelsplatz in Dortmund ist aus dieser Zeit bekannt, an dem wohl Getreide und Eicheln für Handelszwecke aufbereitet worden sind.
Lediglich aus der frühen Bronzezeit kennen wir repräsentative Siedlungsplätze in Westfalen. In Bocholt, Rhede (beide Kreis Borken) und Telgte (Kreis Warendorf) sind Grundrisse von rechteckigen Langhäusern mit Walmdächern und halbkreisförmigen Schmalseiten ergaben worden.
Die für diese Zeitperiode namengebenden Bronzefunde sind in Siedlungen äußerst selten. Lediglich aus der frühbronzezeitlichen Siedlung von Rhede ist eine Stabdolchklinge bekannt. Die Gründe für das weitgehende Fehlen liegen im Wert des Metalls. Die Rohstoffe der Bronzelegierung (90 % Kupfer, 10 % Zinn) kommen in Westfalen nicht natürlich vor und mussten importiert werden. Ihr Gegenwert musste in Naturalien erwirtschaftet werden. Die wenigen bekannten Siedlungen aus späteren Abschnitten der Bronzezeit sind ebenfalls frei von Bronzegegenständen. Aus den Siedlungsplätzen lassen sich weitere Aufschlüsse über die Umwelt des bronzezeitlichen Menschen gewinnen. Mangelernährung und geringe medizinische Kenntnisse führten u. a. zu einer hohen Kindersterblichkeit. Man bestattete die Kinder in der frühen Bronzezeit direkt in der Siedlung, nicht auf den zugehörigen Gräberfeldern, wie ein Kindergrab in zwei zusammengeschobenen Haushaltsgefäßen aus Ostbevern-Schirl/Kreis Warendorf zeigt.
Eine Besonderheit des frühbronzezeitlichen Siedlungswesens in Westfalen ist die Wallburg auf dem Schweinskopf bei Tecklenburg-Brochterbeck (Kreis Steinfurt). Im 17. Jh. v. Chr. errichtete man hier eine Befestigung auf einem Bergsporn, vermutlich um einen Passübergang des Teutoburger Waldes zu kontrollieren. Als bisher einzige bronzezeitliche Befestigung Westfalens ist sie Indikator für eine Machtkonzentration in der frühen Bronzezeit. Zur Errichtung einer solchen Anlage war ein funktionierendes Gemeinwesen mit hierarchischen Strukturen notwendig.
Die Hauptquellen für die Bronzezeit Westfalens sind aber nicht die Siedlungen, sondern die Grabfunde. In der frühen Bronzezeit wurden offenbar nur die Angehörigen einer Oberschicht individuell unter monumentalen Grabhügeln aus Steinen, Lehm oder Sand bestattet. Die Toten wurden in seitlicher Hockerlage niedergelegt, ohne Bronzegegenstände als Grabbeigaben, jedoch mit Äxten und Dolchen aus Stein, die häufig den Formen von Bronzegeräten nachempfunden waren.
Auch in der mittleren Bronzezeit bestattete man die Toten weiterhin unter Grabhügeln, nun allerdings in gestreckter Rückenlage und erstmals mit Beigaben aus Bronze, häufig Schwerter der Typen Sögel und Wohlde (nach einem niedersächsischen bzw. einem schleswig-holsteinischen Fundplatz benannt), kombiniert mit einer Lanze oder einem Beil. Der Grabbezirk wurde durch Pfostenkränze, Steinkreise oder ähnliches abgegrenzt. Die Verbreitung dieser Männergräber des sog. Sögel-Wohlde-Kreises beschränkt sich ebenso auf Ostwestfalen und Lippe, wie die etwas jüngeren, aber ebenfalls mittelbronzezeitlichen Frauenbestattungen mit Schmuckbeigaben, in der Regel sog. Doppelradnadeln. Als Besonderheit der mittleren Bronzezeit in Westfalen sind Brandbestattungen unter den Grabhügeln zu nennen, in denen z. T. sogar Holzsärge oder eigens aus Eichenbohlen gezimmerte "Totenhütten" mit verbrannt wurden (sog. Paderborner Gruppe). Dadurch setzen sie sich von der üblichen Bestattungsweise in Körpergräbern der Hügelgräberbronzezeit in umliegenden Nordhessen oder Niedersachsen (sog. Lüneburger Gruppe) deutlich ab.
Erst ab der jüngeren Bronzezeit finden sich größere Gräberfelder, auf denen die Toten dann grundsätzlich verbrannt bestattet wurden, so z. B. ab 1200 v. Chr. in Warendorf-Neuwarendorf, mit über 3.000 jungbronzezeitlichen Gräbern. Der Leichenbrand (ca. 1,6-2,0 kg bei einem Erwachsenen) wurde sorgsam aus der Asche ausgelesen, gewaschen und in einem Tongefäß als Urne (Urnengrab) oder einem Beutel oder Tuch (sog. Leichenbrandnest, da sich in der Regel nur die Knochen erhalten haben) beigesetzt. Zusätzlich wurden die Urnen häufig mit einem Stein oder einer umgedrehten Schale abgedeckt und mit Grabbeigaben (ein oder zwei Gefäße mit Speisebeigaben, bronzene Pinzetten und sog. Rasiermesser) ausgestattet. Die Gräber wurden äußerlich durch Hügel, umgeben von Kreis- oder Schlüssellochgräben kenntlich gemacht. Letztere sind gerade für Westfalen und das südwestliche Niedersachsen (sog. Ems-Gruppe) charakteristisch.
Eine außergewöhnliche Grabbeigabe stammt aus einem Kindergrab in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh). Es handelt sich um ein verziertes Bronzebecken, das vermutlich aus Sachsen-Anhalt importiert wurde. Diese Kostbarkeit zeigt sicher ebenso die Zugehörigkeit zu einer Oberschicht an, wie eine reich verzierte Bronzesitula aus Gevelinghausen (Hochsauerlandkreis) aus dem 8. Jh. v. Chr., die als Urne diente. Das Gefäß, das mit seiner Symbolik (sog. Vogel-Sonnen-Barke) in den kultischen Bereich gehört, ist durch Abbrechen eines Henkels "entweiht" worden, um es als Urne verwenden zu können. Ähnliches lässt sich bei anderen Gefäßen dieser Art in ganz Mitteleuropa beobachten, von denen das Gevelinghausener das schönste und besterhaltenste ist.
Weitere Metallfunde stammen in Westfalen neben den Grabfunden in erster Linie aus Horten. Einzelne Beile oder Äxte könnten auch einfach verloren gegangen sein, Deponierungen mit zwei oder mehreren Stücken dienten aber sicher entweder als Rohstoff- oder Warenlager, Schatzversteck oder aber als Opfergabe. Sind die Stück allesamt fragmentiert oder beschädigt, handelt es sich vermutlich um ein Altmetalllager. Komplett erhaltene und hochwertige Stücke kommen für einen persönlichen Schatz, Handelsware oder Opfer in Frage, letzteres vor allem, wenn die Stücke in einem Gewässer oder Moor deponiert wurden. Ein großer Teil bronzezeitlicher Deponierungen entzieht sich einer sicheren Deutung, allerdings fällt auf, dass es sich häufig um "erlesene" Stücke handelte, die importiert werden mussten. So wird vor allem an den Hortfunden deutlich, dass man in Westfalen wirtschaftlich in der Lage war, sich diese Gegenstände trotz des Rohstoffmangels zu besorgen. Wogegen diese Rohstoffe getauscht wurden, lässt sich im Einzelnen kaum erschließen. Lediglich ein Handelsplatz in Dortmund ist aus dieser Zeit bekannt, an dem wohl Getreide und Eicheln für Handelszwecke aufbereitet worden sind.

Bronzezeitliches Wohn-Stall-Haus aus Telgte-Woeste/Kreis Warendorf, Rekonstruktion im Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen

Zwei bronzene Dolchklingen aus Rhede/Kreis Borken, um 1500 v. Chr.

Grabbeigaben eines Mannes aus der mittleren Bronzezeit aus Petershagen-Döhren/Kreis Minden-Lübbecke
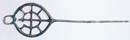
Doppelradnadel aus einem mittelbronzezeitlichen Frauengrab aus Werther/Kreis Gütersloh

Urnenbestattung aus dem Gräberfeld der jüngeren Bronzezeit bis älteren vorrömischen Eisenzeit aus Vreden/Kreis Borken

Rekonstruktion der "Schlüssellochgräber" auf dem jungbronzezeitlichen Friedhof von Nordrheda/Kreis Gütersloh

Verziertes Bronzebecken aus einem jungbronzezeitlichen Kindergrab in Rheda-Wiedenbrück/Kreis Gütersloh

Bronzeamphore aus Gevelinghausen/Hochsauerlandkreis, 9./8. Jh. v. Chr.
5. Bevor die Römer kamen -
Vorrömische Eisenzeit (ca. 750 bis 12 v. Chr.)
Mit der Kenntnis der Eisentechnologie verbesserte sich die Rohstoffversorgung deutlich. Eisenerz steht fast überall an - im Siegerland als Brauneisenstein, der oberflächennah abgebaut werden konnte, in den Löss- und Kalkgebieten des Münsterlandes als Eisenkonkretionen im Boden (sog. Geoden), im Sandstein des Eggegebirges als Bohneisenerz und in den feuchten Niederungen als Raseneisenerz. Der zweite wichtige Rohstoff, die Holzkohle konnte vor Ort vermeilert werden. In aus Lehm aufgebauten Öfen wurde so im sog. Rennfeuerverfahren das Roheisenerz von der Schlacke getrennt. Die nötige Temperatur von ca. 1.300 °C konnte mit Holzkohle erreicht werden. Das bislang kaum besiedelte Siegerland war ab ca. 500 v. Chr. auf Erzabbau und dessen Weiterverarbeitung regelrecht spezialisiert. Durch Handel wurde Eisen in Form schwertförmiger Barren vor allem ins Münsterland vertrieben. Weitere Produkte waren Tüllenmeißel, Tüllenbeile und Pflugscharen. Der Hauptexportstrom des siegerländischen Eisens ging aber in keltische Gebiete (in die Wetterau und an den Rhein). Mit dem Zusammenbruch der keltischen Welt kurz vor Christi Geburt brach auch die Nachfrage nach Siegerländer Eisen zusammen.
Ein weiteres marktorientiert produziertes Handelsgut war Salz. Am Hellweg und am Südfuß des Teutoburger Waldes verläuft ein Streifen mit Salzquellen, deren Nutzung schon seit dem 6. Jh. v. Chr. (zumindest in Werl, Kreis Soest) vermutet wird. Die gängige Vorstellung einer eisenzeitlichen Gesellschaft mit verstreuten Selbstversorgern, wie sie die Siedlungsplätze in Westfalen mit Keramik geringer Qualität, kaum Objekten aus Bronze und Eisen suggerieren, ist vielleicht gar nicht zutreffend, denn auch in der Landwirtschaft konnten Handelswaren als marktorientierte Überschussproduktion hergestellt werden. In der Siedlung von Nordrheda (Kreis Gütersloh) wurde eine große Anzahl Speicherbauten entdeckt, die für eine solche Überproduktion sprechen könnte.
In den Siedlungen finden sich neben einfachen Mahlsteinen aus anstehendem Steinmaterial auch importierte Drehmühlen aus Mayener Basalt, einem Lavagestein aus der Eifel, die in der Gegend um Mayen in spezialisierten Werkstätten hergestellt wurden. Der Import dieser schweren Drehmühlen wirft ein weiteres Licht auf die logistischen Fähigkeiten in der vorrömischen Eisenzeit.
Ein weiteres marktorientiert produziertes Handelsgut war Salz. Am Hellweg und am Südfuß des Teutoburger Waldes verläuft ein Streifen mit Salzquellen, deren Nutzung schon seit dem 6. Jh. v. Chr. (zumindest in Werl, Kreis Soest) vermutet wird. Die gängige Vorstellung einer eisenzeitlichen Gesellschaft mit verstreuten Selbstversorgern, wie sie die Siedlungsplätze in Westfalen mit Keramik geringer Qualität, kaum Objekten aus Bronze und Eisen suggerieren, ist vielleicht gar nicht zutreffend, denn auch in der Landwirtschaft konnten Handelswaren als marktorientierte Überschussproduktion hergestellt werden. In der Siedlung von Nordrheda (Kreis Gütersloh) wurde eine große Anzahl Speicherbauten entdeckt, die für eine solche Überproduktion sprechen könnte.
In den Siedlungen finden sich neben einfachen Mahlsteinen aus anstehendem Steinmaterial auch importierte Drehmühlen aus Mayener Basalt, einem Lavagestein aus der Eifel, die in der Gegend um Mayen in spezialisierten Werkstätten hergestellt wurden. Der Import dieser schweren Drehmühlen wirft ein weiteres Licht auf die logistischen Fähigkeiten in der vorrömischen Eisenzeit.
Vor allem im 3./2. Jh. v. Chr. wurden in Westfalen zahlreiche Höhensiedlungen befestigt. Glaubte man früher, es habe sich um reine Fluchtburgen für die Bevölkerung in Notzeiten gehandelt, so sind heute auch Spuren dauerhafter Besiedlung aus vielen Anlagen bekannt, z. B. aus der Wittekindsburg an der Porta Westfalica oder der Babilonie bei Blasheim (beide Kreis Minden-Lübbecke), wo sich u. a. eine Gussform zur Schmuckherstellung fand. In Ostwestfalen und Lippe gibt es ca. 30 solcher Wallburgen, die mit Holz-Erde-Mauern oder Pfostenschlitzmauern befestigt waren.
Auch aus der Eisenzeit stammen zahlreiche Hortfunde. In den Höhlen des Sauerlandes sind Opferhandlungen vorgenommen worden, bei denen wohl auch Menschen geopfert worden sind, z. B. in der Balver Höhle (Märkischer Kreis) oder im "Hohlen Stein" (Kallenhardt, Kreis Soest). Des Weiteren finden sich Gewässer- und Mooropferplätze, z. B. in Hille-Unterlübbe (Kreis Minden-Lübbecke), Soest-Ardey und Nieheim-Sommersell (Kreis Höxter).
Die seit der jüngeren Bronzezeit bestehende Sitte der Totenverbrennung wurde in der Eisenzeit weitergeführt. Daher sind Grabbeigaben meistens schlecht erhalten. Eine Ausnahme ist der Friedhof von Petershagen-Ilse (Kreis Minden-Lübbecke). Dort wurden fast nur Frauen, allesamt unverbrannt bestattet. Anhand ihrer Tracht ist zu vermuten, dass sie nicht aus Westfalen, sondern aus Südwestdeutschland, dem Elsass oder der Schweiz stammen und um 550 v. Chr. hier bestattet wurden. Im Jahr 2006 durchgeführte Strontium-Isotopen-Untersuchungen bestätigen diese Annahme.
Im südlichen Westfalen, dem keltisch geprägten "Industriegebiet" dieser Zeit, vollzog sich um 300 v. Chr. ein grundlegender Wandel der Bestattungssitten. Es steht nicht mehr das Urnengrab im Mittelpunkt, sondern der Bestattungsvorgang, also der Verbrennungsprozess selbst. Die Grabgrube diente fortan dazu, die Reste des Scheiterhaufens zu entsorgen. Man spricht von sog. Brandgrubengräbern. Trotz der scheinbaren Sorglosigkeit, mit der die Toten verscharrt wurden, finden sich immer wieder "schöne" Beigaben, z. B. eiserne Fibeln, geschmolzene Glasperlen und Korallenfibeln oder die durch das Feuer stark beschädigte Schmuckgarnitur aus Milte (Kreis Warendorf) aus Bronze, Bernstein und Eisen. In Petershagen-Lahde (Kreis Minden-Lübbecke) lagen in Gräbern des letzten vorchristlichen Jahrhunderts eiserne Fibeln, die einen elbgermanischen Einfluss zeigen. Darin spiegelt sich offensichtlich ein gewisser Druck von Ost nach West wider, der letztlich Kaiser Augustus dazu bewog, mit römischen Legionen vom Rhein aus ostwärts nach Germanien vorzustoßen. Aus Petershagen-Lahde stammen Grabbeigaben aus dieser Zeit, die dem provinzialrömischen Haltern-Horizont folgen.
Auch aus der Eisenzeit stammen zahlreiche Hortfunde. In den Höhlen des Sauerlandes sind Opferhandlungen vorgenommen worden, bei denen wohl auch Menschen geopfert worden sind, z. B. in der Balver Höhle (Märkischer Kreis) oder im "Hohlen Stein" (Kallenhardt, Kreis Soest). Des Weiteren finden sich Gewässer- und Mooropferplätze, z. B. in Hille-Unterlübbe (Kreis Minden-Lübbecke), Soest-Ardey und Nieheim-Sommersell (Kreis Höxter).
Die seit der jüngeren Bronzezeit bestehende Sitte der Totenverbrennung wurde in der Eisenzeit weitergeführt. Daher sind Grabbeigaben meistens schlecht erhalten. Eine Ausnahme ist der Friedhof von Petershagen-Ilse (Kreis Minden-Lübbecke). Dort wurden fast nur Frauen, allesamt unverbrannt bestattet. Anhand ihrer Tracht ist zu vermuten, dass sie nicht aus Westfalen, sondern aus Südwestdeutschland, dem Elsass oder der Schweiz stammen und um 550 v. Chr. hier bestattet wurden. Im Jahr 2006 durchgeführte Strontium-Isotopen-Untersuchungen bestätigen diese Annahme.
Im südlichen Westfalen, dem keltisch geprägten "Industriegebiet" dieser Zeit, vollzog sich um 300 v. Chr. ein grundlegender Wandel der Bestattungssitten. Es steht nicht mehr das Urnengrab im Mittelpunkt, sondern der Bestattungsvorgang, also der Verbrennungsprozess selbst. Die Grabgrube diente fortan dazu, die Reste des Scheiterhaufens zu entsorgen. Man spricht von sog. Brandgrubengräbern. Trotz der scheinbaren Sorglosigkeit, mit der die Toten verscharrt wurden, finden sich immer wieder "schöne" Beigaben, z. B. eiserne Fibeln, geschmolzene Glasperlen und Korallenfibeln oder die durch das Feuer stark beschädigte Schmuckgarnitur aus Milte (Kreis Warendorf) aus Bronze, Bernstein und Eisen. In Petershagen-Lahde (Kreis Minden-Lübbecke) lagen in Gräbern des letzten vorchristlichen Jahrhunderts eiserne Fibeln, die einen elbgermanischen Einfluss zeigen. Darin spiegelt sich offensichtlich ein gewisser Druck von Ost nach West wider, der letztlich Kaiser Augustus dazu bewog, mit römischen Legionen vom Rhein aus ostwärts nach Germanien vorzustoßen. Aus Petershagen-Lahde stammen Grabbeigaben aus dieser Zeit, die dem provinzialrömischen Haltern-Horizont folgen.

Ausgegrabene Reste der Pfostenschlitzmauer der eisenzeitlichen Befestigung auf dem Wilzenberg, Hochsauerlandkreis

Rekonstruktionsversuch der Tracht, mit der die Frauen auf dem Gräberfeld Petershagen-Ilse/Kreis Minden-Lübbecke, um 550 v. Chr. bestattet wurden

Rekonstruiertes Schmuckensemble aus einem Brandgrab in Milte/Kreis Warendorf, um 500 v. Chr.
Das friedliche Miteinander von Römern und Germanen wird mit der Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. und den Rachefeldzügen des Germanicus 15/16 n. Chr. beendet. Mit diesen, in römischen Schriftquellen überlieferten Ereignissen, tritt Westfalen aus der Urgeschichte in das "Licht" der (Früh-)Geschichte.
 Arminius - Varus. Die Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. Ein Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte mit dem LWL-Römermuseum Haltern und dem Lippischen Landesmuseum Detmold mit vielfältigen Informationen und Ressourcen.
Arminius - Varus. Die Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr. Ein Kooperationsprojekt des Internet-Portals "Westfälische Geschichte mit dem LWL-Römermuseum Haltern und dem Lippischen Landesmuseum Detmold mit vielfältigen Informationen und Ressourcen.6. Literatur
6.1 Allgemeine Geschichte
Cunliffe, Barry (Hg.)Illustrierte Vor- und Frühgeschichte Europas. Frankfurt/M. 1996.
Umfangreiche, gut bebilderte Einführung in die Ur- und Frühgeschichte Europas, mit Abschnitten zu jeder Zeitstufe von der Altsteinzeit bis in die Völkerwanderungszeit. Die einzelnen Kapitel sind nach regionalen Gesichtspunkten untergliedert und umfassen alle Bereiche des Lebens von der Siedlungsweise über Wirtschaft und Handel bis hin zu Religion und Kult. Das Werk ist eher als generelle Einführung in die Ur- und Frühgeschichte des gesamten europäischen Raumes zu verstehen, dem speziell auf Westfalen ausgerichteten Leser bieten sich wenig konkrete Informationen.
Egg, Markus / Pare, Christopher
Die Metallzeiten in Europa und im vorderen Orient. Die Abteilung Vorgeschichte im Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer, Band 26. Mainz 1995.
Chronologisch gegliedert deckt dieser Band den Zeitraum von der Kupferzeit über die Bronzezeit bis hin zur Eisenzeit ab. Neben Einführungen in verschiedene Technologien bietet der Band reich illustrierte, regional gegliederte Darstellungen der einzelnen Zeitstufen in ganz Europa und dem vorderen Orient. Die Darstellung beruht auf der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, die darauf ausgerichtet ist, alle Gebiete Europas in gleicher Ausführlichkeit darzustellen und daher zu einem großen Teil aus Repliken besteht. Der Leser sieht daher weniger speziell aus Westfalen stammende Funde als vielmehr ein "who-is-who" der Metallzeiten und erhält einen guten Gesamteindruck dieser Zeitstufen.
Probst, Ernst
Deutschland in der Steinzeit. Jäger, Fischer und Bauern zwischen Nordseeküste und Alpenraum. München 1991.
Das Werk gibt in gut verständlicher Sprache einen Überblick über die gesamte Steinzeit im deutschsprachigen Raum. Eine klare Gliederung nach Zeitstufen, Regionen und archäologischen Kulturen ermöglicht einen guten Einstieg in diese Periode der Urgeschichte. In zahlreichen Abbildungen werden Funde, Verbreitungskarten, Rekonstruktionen und ähnliches gezeigt.
Probst, Ernst
Deutschland in der Bronzezeit. Bauern, Bronzegießer und Burgherren zwischen Nordsee und Alpen. München 1996.
Als Nachfolgeband von "Deutschland in der Steinzeit" ist das Werk vergleichbar aufgebaut. Beim Autor handelt es sich um einen Wissenschaftspublizisten, der sich bei der Ausarbeitung der Themen von führenden Fachwissenschaftlern beraten ließ. Die beiden Bände "Deutschland in der Steinzeit" und Deutschland in der Bronzezeit" richten sich in erster Linie an die interessierte Öffentlichkeit.
6.2 Westfälische Geschichte
Im Wesentlichen ist hier einführende Literatur angegeben, die einen guten Überblick und Einstieg in die Urgeschichte Westfalens bietet. Zu speziellen Aspekten einzelner Zeitstufen oder Regionen gibt es zahlreiche weitere Literatur, die sich aber aus den vorgegebenen Titeln erschließt und hier nicht im Einzelnen wiedergegeben und kommentiert werden kann. Des Weiteren erscheint jedes Jahr der "Neujahrsgruß" des Westfälischen Museums für Archäologie und der Altertumskommission für Westfalen. Dort werden in den Berichten der einzelnen Abteilungen die Aktivitäten und wichtigsten Neufunde des abgelaufenen Jahres einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert. An Fachleute richten sich die Reihen "Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe" mit Artikeln zu verschiedenen Themen der westfälischen Archäologie und einer ausführlichen Fundchronik für Westfalen-Lippe sowie die Reihen "Bodenaltertümer Westfalens" und "Veröffentlichungen der Altertumskommission für Westfalen", die monographisch verschiedene Einzelthemen der westfälischen Ur- und Frühgeschichte behandeln.Baales, Michael
Ein kurzer Gang durch die älteste Geschichte Westfalens. Archäologie in Ostwestfalen 9, 2005, S. 11-37.
Klar gegliedert und in kurzer und verständlicher Form werden, ausgehend von der Klimageschichte die Anfänge und die Entwicklung der Menschheit skizziert und im Folgenden für Westfalen spezifiziert. Der Text ist aus einem Vortrag im Rahmen einer Vortragsreihe für das Westfälische Museum für Archäologie in Herne entstanden und gibt vor allem einen Überblick über die Alt- und Mittelsteinzeit. Die Jungsteinzeit ist etwas knapper zusammengefasst, sodass zu einigen neolithischen Themen wesentliche Aspekte leider fehlen. Das aktuell gehaltene Literaturverzeichnis ermöglicht aber eine Erschließung dieser Themen.
Bérenger, Daniel
Erdgeschichte und Steinzeiten. Vor- und Frühgeschichte der Hochstiftkreise Paderborn und Höxter, Band 1. Bielefeld 2002.
Verhältnismäßig junge Einführung, die eigentlich die Erdgeschichte und Steinzeitperioden der Kreise Paderborn und Höxter, im weiteren Sinne Ostwestfalen beschreibt. Dem Leser wird allerdings eine detaillierte und sehr reich bebilderte Einführung weit über die Grenzen dieser Kreise hinaus geboten. Es sind alle zum Verständnis der behandelten Perioden notwendige Fundplätze von europäischem Rang mit aufgeführt. Vorzüglich, gerade für den Nichtfachmann ist das umfangreiche Glossar am Ende des Bandes.
Bérenger, Daniel
Die vorrömischen Metallzeiten. Vor- und Frühgeschichte der Hochstiftkreise Paderborn und Höxter, Band 2. Bielefeld 2004.
Der zweite Band der Einführung in die Vor- und Frühgeschichte der Kreise Paderborn und Höxter ist in seiner Gliederung dem ersten Band angeglichen. Wiederum erhält der Leser weit mehr an Information, als der Titel ahnen lässt. Die reichliche Bebilderung umfasst, wie schon im ersten Band, Fotos von Funden, Zeichnungen, Pläne und sehr anschauliche farbige Lebensbilder. Ebenfalls mit umfangreichem Glossar ausgestattet, handelt es sich bei den beiden Bänden um eine der besten Einführungen in die westfälische Urgeschichte, die derzeit zu haben ist.
Bérenger, Daniel
Und mit dem Metall geht es weiter. Die vorrömischen Metallzeiten in Westfalen. Archäologie in Ostwestfalen 9, 2005, S. 38-52.
Chronologisch gegliedert, humorvoll und eingängig geschrieben gibt der Artikel, der ebenfalls der Vortragsreihe für das Westfälische Museum für Archäologie entstammt ein Bild der Bronzezeit und der vorrömischen Eisenzeit in Westfalen. Innerhalb der klaren chronologischen Gliederung sind die einzelnen Abschnitte diachron nach Siedlungswesen, Bestattungssitten und Horten/Opferdepots unterteilt.
Bleicher, Wilhelm
Die vorrömischen Metallzeiten.
Wilhelm Kohl (Hrsg.), Westfälische Geschichte. Band 1: Von den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Band XLIII. Düsseldorf 1983. S. 113-142.
Etwas knappe Einführung in die Bronzezeit und vorrömische Eisenzeit Westfalens. Aufgrund des Alters des Beitrages fehlen die aktuellsten Ergebnisse der Forschung. Als genereller Überblick dennoch auch heute noch lesenswert. Die Abbildungen sind als Tafeln in einem gesonderten Bild- und Dokumentarband zur Reihe "Westfälische Geschichte" in ausreichender Zahl und für das Alter des Werkes tragbarer Qualität vorhanden, jedoch macht diese Aufteilung den Artikel etwas unhandlich.
Günther, Klaus
Alt- und mittelpaläolithische Fundplätze in Westfalen. Teil 2: Altsteinzeitliche Fundplätze in Westfalen. Einführung in der Vor- und Frühgeschichte Westfalens, Heft 6, 2. Münster 1988.
Im zweiten Teil des Führers zu alt- und mittelsteinzeitlichen Fundplätzen in Westfalen wird die naturräumliche Lage der Fundstellen nur noch kurz angerissen. Die einzelnen altsteinzeitlichen Abschnitte werden jeweils übersichtsartig beschrieben, gefolgt von Einzelbeschreibungen der wichtigsten Fundplätze. Zeichnungen und Fotos verschaffen einen guten Eindruck der einzelnen Phasen und Fundstellen. Ergänzt wird der Band durch ein Glossar am Ende des Heftes zur Erklärung der Fachbegriffe.
Hellenkemper, Hansgerd / Horn, Heinz Günter / Koschik, Harald / Trier, Bendix (Hg.)
Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Geschichte im Herzen Europas. Begleitbuch zur Landesausstellung "Archäologie in Nordrhein-Westfalen". Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 1. Mainz 1990.
Als Begleitbuch zur ersten archäologischen Landesausstellung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1990 gibt dieser Band einen Überblick zu verschiedensten Themen der Ur- und Frühgeschichte der Region. Bedeutende Fundplätze und die Geschichte der Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen werden in kurzen Artikeln vorgestellt. Für den Nichtfachmann ist es zuweilen schwer, einen Überblick oder ein Gesamtbild einzelner Zeitstufen oder Regionen zu gewinnen. Die einzelnen Fundberichte sind als Highlights der Bodendenkmalpflege der Jahre 1980 bis 1990 konzipiert.
Hellenkemper, Hansgerd / Horn, Heinz Günter / Koschik, Harald / Trier, Bendix (Hg.)
Ein Land macht Geschichte. Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Begleitbuch zur Landesausstellung "Ein Land macht Geschichte". Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 3. Mainz 1995.
Als Begleitbuch zur zweiten archäologischen Landesausstellung in Nordrhein-Westfalen gibt das Werk als "Leistungsschau" der nordrhein-westfälischen Bodendenkmalpflege einen allgemeinen Überblick mit einführenden Beiträgen. Daneben finden sich Beiträge mit regionaler Übersicht und chronologisch geordnete Artikel. Der Band schließt in Aufmachung und Gliederung an den Katalog der ersten Landesausstellung aus dem Jahre 1990 an. Der Schwerpunkt liegt auf den Funden der Jahre 1990 bis 1994.
Hellenkemper, Hansgerd / Horn, Heinz Günter / Isenberg, Gabriele / Koschik, Harald (Hg.)
Fundort Nordrhein-Westfalen. Millionen Jahre Geschichte. Begleitbuch zur Landesausstellung "Fundort Nordrhein-Westfalen". Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 5. Mainz 2000.
Der Begleitband zur dritten archäologischen Landesausstellung in Nordrhein-Westfalen umfasst neben einführenden Aufsätzen eine Reihe von Artikeln, die einen Überblick über die letzten 25 Jahre archäologischer Forschung in Nordrhein-Westfalen geben. Es folgen Artikel der kommunalen Bodendenkmalpflegedienste mit den Funden der Jahre 1995 bis 1999 und chronologisch geordnete Beiträge. Leider ist es für Nichtfachleute nicht immer ganz einfach, den Überblick in den einzelnen Artikeln zu behalten.
Hellenkemper, Hansgerd/Horn, Heinz Günter/Isenberg, Gabriele/Kunow, Jürgen (Hrsg.)
Von Anfang an. Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Begleitbuch zur Landesausstellung "Von Anfang an". Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 8. Mainz 2005.
Der jüngste Begleitband zur archäologischen Landesausstellung in Nordrhein-Westfalen folgt dem bewährten Schema seiner Vorgänger und bietet eine archäologische Leistungsschau der Jahre 2000-2004. Wie in den Bänden vorangegangener Landesausstellungen ist es auch hier für den Nichtfachmann z. T. schwer einen kompletten Überblick zu erlangen. Einige Artikel sind inhaltlich nicht wirklich populärwissenschaftlich ausgelegt, sondern erfordern etwas Hintergrundwissen, zumindest aber ein Glossar, was den Bänden leider fehlt.
Horn, Heinz Günter (Hrsg.)
Theiss Archäologieführer Westfalen-Lippe. Stuttgart 2008
Nach einer kurzen Einführung in die Ur- und Frühgeschichte der Region folgt eine Darstellung einzelner archäologischer Denkmäler von der Steinzeit bis in die frühe Neuzeit in kurzen, gut lesbaren Artikeln. Die einzelnen Objekte sind durch kurze Anfahrtsbeschreibungen in den Artikeln gut zu finden.
Narr, Karl J.
Die Steinzeit. Wilhelm Kohl (Hrsg.), Westfälische Geschichte. Band 1: Von den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Band XLIII. Düsseldorf 1983. S. 81-111.
Kurze prägnante Zusammenfassung der steinzeitlichen Perioden in Westfalen. Gut für den ersten Überblick geeignet, allerdings mit der Einschränkung, dass das Werk aufgrund seines Alters z. T. forschungsgeschichtlich überholt ist. Die geringe Menge der Abbildungen ist nicht geeignet, Nichtfachleuten einen vollständigen Eindruck des steinzeitlichen Fundgutes in Westfalen zu geben.
Speetzen, Eckhard
Alt- und mittelpaläolithische Fundplätze in Westfalen. Teil 1: Das Eiszeitalter in Westfalen. Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Westfalens, Heft 6, 1. Münster 1986.
Das Heft befasst sich mit der Erdgeschichte, der klimatischen Entwicklung, der Fauna und Flora und der Entwicklung des eiszeitlichen Menschen bis zum Holozän. Besonders positiv hervorzuheben ist das Glossar am Ende des Heftes, das im Text verwendete Fachbegriffe erläutert und das Heft so zu einem gut lesbaren Einstieg in die Erdgeschichte Westfalens macht.
Tackenberg, Kurt
Westfalen in der Urgeschichte Nordwestdeutschlands. Der Raum Westfalen, Band V, 2. Münster 1996.
Der postum herausgegebene und von Fachkollegen aktualisierte Band legt als Teil des Raumwerkes "Der Raum Westfalen" 46 Fundkarten zur Urgeschichte von der Altsteinzeit bis zur vorrömischen Eisenzeit vor. Die Fundkarten Tackenbergs werden durch Fundzeichnungen und erläuternde Texte ergänzt. Dem Leser wird allerdings weniger ein Gesamtüberblick über die westfälische Urgeschichte geboten sondern vielmehr ein Katalog der archäologischen Leitformen der einzelnen Perioden und deren Verbreitungsbild. Damit ist der Band für Nichtfachleute weniger ansprechend.
Westfälisches Museum für Archäologie (Hg.)
Das Museum. Westfälisches Museum für Archäologie. Landesmuseum. Münster 2004.
Das Begleitheft zum Westfälischen Museum für Archäologie in Herne stellt auf 89 Seiten die aktuelle Dauerausstellung des Museums vor. Es löst damit die z. T. recht alten Bände der Reihe Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Westfalens ab, wenngleich die Publikation vom Umfang völlig anders angelegt ist und nicht als Ersatz im eigentlichen Sinne dienen soll. Zusätzlich wird die Konzeption und Architektur des Hauses vorgestellt. Mit einer üppigen Bebilderung von ca. 200 Farbbildern, häufig leider recht klein, ist der Band sehr gut ausgestattet.
6.3 Führer zu archäologischen Geländedenkmälern
Führer zu archäologischen GeländedenkmälernAus der mittlerweile 43 Bände umfassenden Reihe sind folgende Bände über Regionen in Westfalen erschienen:
10/11: Der Kreis Lippe. Stuttgart 1985 (zugleich: Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Westfalens, Heft 4).25: Der Kreis Siegen-Wittgenstein. Stuttgart 1993.
38: Die Stadt Soest. Archäologie und Baukunst. Stuttgart 2000.
39: Der Kreis Soest. Stuttgart 2001.
Die Westfalen betreffenden Bände dieser Reihe sind sehr gute Einführungen in die regionale Ur- und Frühgeschichte. Einleitend werden die naturräumlichen Gegebenheiten, Geologie und Klima umrissen. Nach einem forschungsgeschichtlichen Abriss folgen regionale Beschreibungen der einzelnen Zeitstufen. Den größten Teil der Führer nehmen kurze, gut lesbare Objekt- bzw. Denkmälerbeschreibungen ein, die nicht nur archäologische, sondern auch bedeutende oder archäologisch relevante Baudenkmäler mit einbeziehen. Es finden sich Anfahrtsbeschreibungen, sodass die entsprechenden Denkmäler im Gelände gut zu finden und anhand der bündigen Beschreibungen auch für Nichtfachleute gut zu erschließen sind. In den älteren Bänden finden sich neben Zeichnungen leider keine farbigen Abbildungen.
Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern in Deutschland.
Die 50 Bände umfassende Reihe ist Anfang der 1980er Jahre eingestellt worden. Sie ist die Vorgängerreihe der "Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland" und wird seit 1983 von diesen fortgeführt. Folgende Bände sind über Regionen in Westfalen erschienen:
4: Hameln, Deister, Rinteln, Minden. Mainz 1975.20: Paderborner Hochfläche. Paderborn, Büren, Salzkotten. Mainz 1971.
45/46: Münster, Westliches Münsterland, Tecklenburg. Mainz 1980/1981.
Der Aufbau ist ähnlich, jedoch sind die Führer nach heutigen Maßstäben nicht mehr ausreichend bebildert und der Forschungsstand überholt. Farbabbildungen fehlen. Die Anfahrtsbeschreibungen sind z. T. nicht mehr aktuell und mit Vorsicht zu genießen.
7. Links
Stand des Haupttextes: 2004.




 Aufrufe gesamt: 24673
Aufrufe gesamt: 24673