Ereignisse > Ereignis des Monats Juli
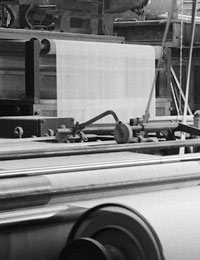
Karl Ditt
15. Juli 1879 -
Das Schutzzollgesetz und seine Konsequenzen für die münsterländische Baumwollindustrie
Am 15.07.1879 erließ das Deutsche Reich das  "Gesetz, betreffend den Zolltarif des Deutschen Zollgebiets und den Ertrag der Zölle und der Tabacksteuer". Damit wurden die bestehenden Zölle auf landwirtschaftliche Rohstoffe, Eisen und Stahl, Textilien und andere Waren deutlich erhöht. Das Gesetz beendete die zu Beginn der 1860er Jahre eingeführte Phase des "Freihandels", d. h. der vergleichsweise niedrigen Zölle.
"Gesetz, betreffend den Zolltarif des Deutschen Zollgebiets und den Ertrag der Zölle und der Tabacksteuer". Damit wurden die bestehenden Zölle auf landwirtschaftliche Rohstoffe, Eisen und Stahl, Textilien und andere Waren deutlich erhöht. Das Gesetz beendete die zu Beginn der 1860er Jahre eingeführte Phase des "Freihandels", d. h. der vergleichsweise niedrigen Zölle.Mehrere Ursachen waren für diesen Wandel der Wirtschaftspolitik ausschlaggebend. Zum Ersten hatte sich das Reich in den 1870er Jahren in der Getreideversorgung von einem Export- in ein Importland verwandelt. Die Großagrarier im Osten Deutschlands sprachen sich deshalb für Schutzzölle aus, um zumindest ihren Absatz auf dem Binnenmarkt zu halten. Zum Zweiten war die deutsche Wirtschaft nach dem Wirtschaftsboom im Gefolge der Reichsgründung von 1871 in eine Phase der Stagnation und des Konjunkturabschwungs geraten, so dass die ausländische Konkurrenz auf dem Binnenmarkt nicht nur strukturell, sondern auch aktuell fühlbarer wurde. Die Einführung der Schutzzölle im Jahre 1879 zum "Schutz der nationalen Arbeit", wie die Interessenvertretungen der Industrie argumentierten, sollte also die deutsche Wirtschaft vor der Konkurrenz schützen - sie waren keine "Erziehungszölle", die zarte Pflanzen entstehender Branchen bewahren, sondern eher Maßnahmen, die den Absatz und die Profite auf dem Binnenmarkt sichern sollten. Zum Dritten schließlich war auch das Deutsche Kaiserreich daran interessiert, durch die Erhebung von Zöllen, deren Erträge nur ihm und nicht den Ländern zugute kam, seine Einnahmesituation zu verbessern.
Erreichte die Schutzzollerhöhung ihre Zielsetzung? Diese Frage soll hier am Beispiel einer der von den Schutzzöllen bedachten Branchen und einer Region, der Textil-, insbesondere Baumwollindustrie des Münsterlandes, behandelt werden.
Die münsterländische Textilindustrie vor der Schutzzollerhöhung des Jahres 1879
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Münsterland vor Minden-Ravensberg die dominierende Textilregion Westfalens: 1819 liefen im Regierungsbezirk Münster 12.380 und 1861: 24.909 Webstühle, im Regierungsbezirk Minden dagegen 8.728 bzw. 14.454 Webstühle. Auch der Anteil der Textilbeschäftigten an der Gesamtbeschäftigtenzahl in Industrie und Handwerk war deutlich größer: Im Jahre 1858 waren im Regierungsbezirk Münster 30.577 Personen oder 51,8 v. H. der Beschäftigten von Industrie und Handwerk im Textilgewerbe beschäftigt, im Regierungsbezirk Minden dagegen 19.673 Personen oder 43 v. H. Charakteristikum der münsterländischen Textil-, d. h. zunächst der Leinen-, dann der Baumwollindustrie war, dass sich hier die Textilkaufleute über zahlreiche Dörfer und Kleinstädte verteilten. Viele waren nur im Nebengewerbe Garn- und Stoffhändler und verkauften ihre Waren zumeist an niederländische und hansische Überseekaufleute weiter. Infolgedessen waren ihre Möglichkeiten zum Erwerb großer Vermögen begrenzt; die münsterländischen Textilkaufleute erreichten deshalb keineswegs die Kapitalkraft und Bedeutung etwa der Bielefelder Leinenhändler. Münster als naheliegender Vorort des münsterländischen Textilgewerbes entwickelte sich im 18. und 19. Jahrhundert auch weniger zu einem Textilhandelszentrum als zum Verwaltungsmittelpunkt des Fürstbistums bzw. der Provinz.
Das münsterländische Textilgewerbe bestand zu Beginn des 19. Jahrhunderts weitgehend aus der Herstellung groben Flachsgarns und Leinengewebes. Sie unterlagen vor allem seit den 1830er Jahren der Konkurrenz durch mechanisch hergestellte Produkte aus Ulster und Flandern. Als sich der strukturelle Preisverfall und Exportrückgang der münsterländischen Grobleinenprodukte verschärfte, folgten die typischen Versuche zur Verbesserung der traditionellen Produktionsweise, dann die Abwanderung zahlreicher Heimgewerbetreibender in den boomenden Ruhrbergbau oder die Auswanderung nach Übersee, in den 1850er Jahren auch die ersten Versuche zur eigenen Mechanisierung der Flachsspinnerei.
Der entscheidende Schritt aus der Krise des Leinengewerbes war jedoch weniger die Mechanisierung der Spinnerei und Weberei als vielmehr die Einführung der Baumwollweberei im Verlagssystem. Damit nutzte das Münsterland relativ spät einen Ausweg, der in mehreren europäischen Leinenregionen zumeist schon im Verlauf des 18. Jahrhunderts begangen worden war. Das unmittelbare Vorbild bildete die Entwicklung jenseits der Grenze zu den Niederlanden, in der Twente. Nach der Verselbständigung der südlichen Niederlande zum Staate Belgien im Jahre 1831, d. h. dem Wegfall der Textilregion Flandern, hatte der verbleibende niederländische Staat den Aufbau einer eigenen Baumwollindustrie in der Twente gefördert, um den Binnenmarkt und den sicheren Absatzmarkt der ostindischen Kolonien durch eine eigene Industrie zu versorgen. Daraufhin waren hier zwischen 1830 und 1860 zahlreiche Baumwollspinnereien und -webereien gegründet worden. Der wachsende Absatz dieser Betriebe sowie die vergleichsweise geringe Kapitalkraft und Aktivität der westmünsterländischen Textilkaufleute reizten bereits in den 1830er Jahren niederländische Kaufleute und Unternehmer, den angrenzenden deutschen Arbeitsmarkt zu nutzen, d. h. dort das Verlagssystem einzuführen und die Leinen- auf die Baumwollproduktion umzustellen; die Staatsgrenze bildete dabei keine Barriere. Angeregt durch das niederländische Vorbild und die steigenden Absatzmöglichkeiten für Baumwollstoffe stellten sich dann seit der Mitte der 1830er Jahre auch mehrere einheimische Kaufleute auf den Baumwollverlag um und gründeten Faktoreien. Die Initiative hierzu kam weniger aus den Kaufmanns- oder Weberkreisen Bocholts oder Nordhorns, wo bereits seit dem 16. Jahrhundert sog. Baumseidenartikel, d. h. Stoffe, deren Kette aus Flachsgarn und deren Schuss aus Baumwollgarn bestand, hergestellt wurden, sondern von mehreren Leinenkaufleuten des nördlichen Westmünsterlandes, insbesondere von der neugegründeten Firma Kümpers & Timmermann in Rheine.
Das münsterländische Textilgewerbe bestand zu Beginn des 19. Jahrhunderts weitgehend aus der Herstellung groben Flachsgarns und Leinengewebes. Sie unterlagen vor allem seit den 1830er Jahren der Konkurrenz durch mechanisch hergestellte Produkte aus Ulster und Flandern. Als sich der strukturelle Preisverfall und Exportrückgang der münsterländischen Grobleinenprodukte verschärfte, folgten die typischen Versuche zur Verbesserung der traditionellen Produktionsweise, dann die Abwanderung zahlreicher Heimgewerbetreibender in den boomenden Ruhrbergbau oder die Auswanderung nach Übersee, in den 1850er Jahren auch die ersten Versuche zur eigenen Mechanisierung der Flachsspinnerei.
Der entscheidende Schritt aus der Krise des Leinengewerbes war jedoch weniger die Mechanisierung der Spinnerei und Weberei als vielmehr die Einführung der Baumwollweberei im Verlagssystem. Damit nutzte das Münsterland relativ spät einen Ausweg, der in mehreren europäischen Leinenregionen zumeist schon im Verlauf des 18. Jahrhunderts begangen worden war. Das unmittelbare Vorbild bildete die Entwicklung jenseits der Grenze zu den Niederlanden, in der Twente. Nach der Verselbständigung der südlichen Niederlande zum Staate Belgien im Jahre 1831, d. h. dem Wegfall der Textilregion Flandern, hatte der verbleibende niederländische Staat den Aufbau einer eigenen Baumwollindustrie in der Twente gefördert, um den Binnenmarkt und den sicheren Absatzmarkt der ostindischen Kolonien durch eine eigene Industrie zu versorgen. Daraufhin waren hier zwischen 1830 und 1860 zahlreiche Baumwollspinnereien und -webereien gegründet worden. Der wachsende Absatz dieser Betriebe sowie die vergleichsweise geringe Kapitalkraft und Aktivität der westmünsterländischen Textilkaufleute reizten bereits in den 1830er Jahren niederländische Kaufleute und Unternehmer, den angrenzenden deutschen Arbeitsmarkt zu nutzen, d. h. dort das Verlagssystem einzuführen und die Leinen- auf die Baumwollproduktion umzustellen; die Staatsgrenze bildete dabei keine Barriere. Angeregt durch das niederländische Vorbild und die steigenden Absatzmöglichkeiten für Baumwollstoffe stellten sich dann seit der Mitte der 1830er Jahre auch mehrere einheimische Kaufleute auf den Baumwollverlag um und gründeten Faktoreien. Die Initiative hierzu kam weniger aus den Kaufmanns- oder Weberkreisen Bocholts oder Nordhorns, wo bereits seit dem 16. Jahrhundert sog. Baumseidenartikel, d. h. Stoffe, deren Kette aus Flachsgarn und deren Schuss aus Baumwollgarn bestand, hergestellt wurden, sondern von mehreren Leinenkaufleuten des nördlichen Westmünsterlandes, insbesondere von der neugegründeten Firma Kümpers & Timmermann in Rheine.
Die Mechanisierung der Baumwollwarenherstellung setzte im Münsterland während der 1850er Jahre im Zuge des allgemeinen Konjunkturaufschwungs ein. Im Vergleich zu den anderen deutschen Baumwollregionen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts, vor allem aber in den 1830er Jahren mechanisierten, war dies sehr spät. Angesichts dieser "relativen Rückständigkeit" wäre nun zu erwarten gewesen, dass die münsterländische Baumwollindustrialisierung sofort auf großbetrieblicher Ebene, mit hohem Kapital- und Bankeneinsatz und auf dem letzten technologischen Stand anlaufen würde, um gegenüber den deutschen und ausländischen Vorreiterregionen aufholen zu können. Dies trat jedoch nicht ein. Die zu Beginn der 1850er Jahre in Nordhorn, Gronau, Borghorst, Emsdetten und Greven gegründeten Spinnereien hatten eine Größenordnung von 800 bis 3.000 Spindeln; ihnen folgte seit dem Ende der 1850er Jahre der Bau von kleinen Baumwollwebereien ebenda sowie in Bocholt, Gemen, Gescher, Ochtrup, Neuenkirchen und Rheine. 1861 betrug im Regierungsbezirk Münster die Zahl der mechanischen Baumwollspindeln knapp 60.000 und Zahl der mechanischen Webstühle 1.317, 1875 im Handelskammerbezirk Münster 130.000 Spindeln und 6.000 Webstühle. Der Absatz beschränkte sich faktisch auf dem innerdeutschen Raum.
Diese Größenordnungen waren im Vergleich zu anderen Textilregionen des deutschen Zollvereins wenig beeindruckend. Vermutlich wären die Baumwollindustrie des Westmünsterlandes im Stadium des Klein- und Mittelbetriebes und die Leinenherstellung heimgewerblich geblieben, ja die Region hätte vielleicht sogar wie der Kreis Tecklenburg eine Reagrarisierung erlebt, wenn nicht im Jahre 1879 das Deutsche Reich zur Schutzzollpolitik übergegangen wäre. Wie geplant schützte diese Maßnahme die deutsche Textilindustrie vor ausländischer, insbesondere englischer Konkurrenz. Die Garnzölle wurden gestaffelt nach Feinheit progressiv erhöht; dasselbe galt für Gewebe. Zwischen 1870 und 1900 ging der Importanteil an Baumwollgarnen von 20 auf 10 v. H. der deutschen Produktion zurück - letztlich wurden nur noch die feinen Garne aus England und der Schweiz importiert. Dies trug wesentlich dazu bei, dass die Zahl der Baumwollspindeln und -webstühle in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg um 140 bzw. 180 v. H. stieg.
Diese Größenordnungen waren im Vergleich zu anderen Textilregionen des deutschen Zollvereins wenig beeindruckend. Vermutlich wären die Baumwollindustrie des Westmünsterlandes im Stadium des Klein- und Mittelbetriebes und die Leinenherstellung heimgewerblich geblieben, ja die Region hätte vielleicht sogar wie der Kreis Tecklenburg eine Reagrarisierung erlebt, wenn nicht im Jahre 1879 das Deutsche Reich zur Schutzzollpolitik übergegangen wäre. Wie geplant schützte diese Maßnahme die deutsche Textilindustrie vor ausländischer, insbesondere englischer Konkurrenz. Die Garnzölle wurden gestaffelt nach Feinheit progressiv erhöht; dasselbe galt für Gewebe. Zwischen 1870 und 1900 ging der Importanteil an Baumwollgarnen von 20 auf 10 v. H. der deutschen Produktion zurück - letztlich wurden nur noch die feinen Garne aus England und der Schweiz importiert. Dies trug wesentlich dazu bei, dass die Zahl der Baumwollspindeln und -webstühle in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg um 140 bzw. 180 v. H. stieg.
 Königreich Preußen: "Zollvereinigungs-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Seiner Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten von Hessen und Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen einerseits, dann Seiner Majestät dem Könige von Bayern und Seiner Majestät dem Könige von Württemberg andererseits", 22.03.1833
Königreich Preußen: "Zollvereinigungs-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen, Seiner Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten von Hessen und Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen einerseits, dann Seiner Majestät dem Könige von Bayern und Seiner Majestät dem Könige von Württemberg andererseits", 22.03.1833 Königreich Preußen: "Vertrag zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll- und Handelsvereine gehörigen Staaten, Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits und Lippe andererseits, den Anschluß des Fürstenthums Lippe an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins", 18.10.1841
Königreich Preußen: "Vertrag zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringischen Zoll- und Handelsvereine gehörigen Staaten, Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits und Lippe andererseits, den Anschluß des Fürstenthums Lippe an das Zollsystem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins", 18.10.1841
Front des Verwaltungsgebäudes und Produktionsanlagen der Textilwerke Laurenz in Ochtrup, um 1970
Der Aufschwung der münsterländischen Baumwollindustrie nach der Schutzzollerhöhung
von 1879
Auch die Baumwollindustriellen des Westmünsterlandes, die sich auf die Deckung des wachsenden Bedarfs an gröberen Garnen und Geweben konzentriert hatten und die keineswegs unzufrieden mit dem bestehenden Zollschutz gewesen waren, profitierten von der Zollerhöhung. So wurde der Bau weiterer Baumwollspinnereien lohnend. Zudem ergänzten viele Baumwollindustrielle ihre Rohweberei durch die Buntweberei, deren Zollschutz nahezu verdoppelt wurde. In Bocholt, Rheine, Ochtrup, Nordwalde, Greven, Coesfeld, Dülmen, ja bis hin nach Warendorf und Gütersloh entstanden jetzt neue Baumwoll-, z. T. auch Leinenwebereien. Zudem begannen auch niederländische Textilfabrikanten wie die van Deldens, Jannings, Jordaans, van Heeks und Stroinks auf deutscher Seite, vor allem in den Grenzstädten Gronau und Nordhorn, Betriebe zu errichten, um die Zölle auf einem ihrer wichtigsten Absatzmärkte zu umgehen. Der Absatz von Deutschland in die Niederlande wurde aufgrund der Kontinuität des dortigen Freihandels kaum behindert. Schließlich wurde auch die Entstehung einer Juteindustrie, die an die Grobleinenherstellung anknüpfte und die seit den 1880er Jahren nach niederländischem Vorbild in Ahaus, Emsdetten und Mesum aufgenommen wurde, erst möglich gemacht.
Abgesehen von den Vorteilen der Schutzzollerhöhung wurde die Textilindustrie des Westmünsterlandes noch dadurch begünstigt, dass diese Region von der Mitte der 1870er Jahre bis zur Jahrhundertwende an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Dadurch wurden die Versorgung der Fabriken mit Kohle aus dem Ruhrgebiet, der Bezug der Rohbaumwolle und der Vertrieb der Waren in die Hauptabsatzmärkte, das Ruhrgebiet, die Niederlande und Norddeutschland, erleichtert. Diese Waren bestanden vor allem aus Futterstoffen, Arbeitsbekleidung, Küchen- und Bettwäsche; es waren zumeist Massenartikeln aus Baumwolle oder Halbleinen, die von einer rapide wachsenden Nachfrage profitieren konnten. Jetzt machten sich auch die verkehrstechnische Rand- und Grenzlage dieser nach wie vor heimgewerblich-landwirtschaftlich strukturierten Region, d. h. ihre relativ niedrigen Löhne, besonders vorteilhaft gegenüber der Konkurrenz bemerkbar.
Infolgedessen setzte seit den späten 1870er Jahren die zweite, eigentliche Industrialisierung des Baumwollgewerbes im Westmünsterland ein; jetzt entstanden Großbetriebe in den Städten, dann Filialgründungen auf dem Lande unter Einsatz der modernsten Technik. Bereits in den 1890er Jahren begann das Westmünsterland nach Spindel- und Webstuhlzahlen die Twente zu übertreffen; dieser Region wurden zudem noch aufgrund der höheren Löhne auf deutscher Seite zahlreiche Arbeitskräfte entzogen. Nach einer Erhebung der Handelskammer Münster soll es 1913/1914 ca. 35.000 Beschäftigte in der Textilindustrie des Regierungsbezirks Münster gegeben haben; davon seien 7.500 Holländer gewesen. Die Dynamik der westmünsterländischen Textilindustrie war vor allem seit den 1890er Jahren so groß, dass sich der Anteil seiner Baumwollbeschäftigten an der Gesamtzahl der Baumwollbeschäftigten des Zollvereins bzw. des Deutschen Reiches von 1846: 3,9 v. H. bis 1907 auf 7,1 v. H. erhöhte. Vor dem Ersten Weltkrieg liefen hier mit 2 Millionen Baumwollspindeln und 45.000 Baumwollwebstühlen etwa 20 bzw. 17 v. H. des deutschen Bestandes. Einzelne Städte wie Bocholt, Gronau oder Nordhorn wurden wirtschaftlich völlig von der Entwicklung der Baumwollindustrie abhängig. Ja, Gronau entwickelte sich zum größten Baumwollspinnereizentrum Deutschlands, und ein Betrieb der Firma Gerrit van Delden & Co. wurde mit 440.000 Spindeln zur größten Baumwollspinnerei des Kontinents. Das Westmünsterland stieg damit neben Elsass-Lothringen, Bayern und Sachsen zu einer der vier größten Baumwollregionen Deutschlands auf.
Infolgedessen setzte seit den späten 1870er Jahren die zweite, eigentliche Industrialisierung des Baumwollgewerbes im Westmünsterland ein; jetzt entstanden Großbetriebe in den Städten, dann Filialgründungen auf dem Lande unter Einsatz der modernsten Technik. Bereits in den 1890er Jahren begann das Westmünsterland nach Spindel- und Webstuhlzahlen die Twente zu übertreffen; dieser Region wurden zudem noch aufgrund der höheren Löhne auf deutscher Seite zahlreiche Arbeitskräfte entzogen. Nach einer Erhebung der Handelskammer Münster soll es 1913/1914 ca. 35.000 Beschäftigte in der Textilindustrie des Regierungsbezirks Münster gegeben haben; davon seien 7.500 Holländer gewesen. Die Dynamik der westmünsterländischen Textilindustrie war vor allem seit den 1890er Jahren so groß, dass sich der Anteil seiner Baumwollbeschäftigten an der Gesamtzahl der Baumwollbeschäftigten des Zollvereins bzw. des Deutschen Reiches von 1846: 3,9 v. H. bis 1907 auf 7,1 v. H. erhöhte. Vor dem Ersten Weltkrieg liefen hier mit 2 Millionen Baumwollspindeln und 45.000 Baumwollwebstühlen etwa 20 bzw. 17 v. H. des deutschen Bestandes. Einzelne Städte wie Bocholt, Gronau oder Nordhorn wurden wirtschaftlich völlig von der Entwicklung der Baumwollindustrie abhängig. Ja, Gronau entwickelte sich zum größten Baumwollspinnereizentrum Deutschlands, und ein Betrieb der Firma Gerrit van Delden & Co. wurde mit 440.000 Spindeln zur größten Baumwollspinnerei des Kontinents. Das Westmünsterland stieg damit neben Elsass-Lothringen, Bayern und Sachsen zu einer der vier größten Baumwollregionen Deutschlands auf.

Spinnweberei F. A. Kümpers KG in Rheine, Produktionssaal der Weberei, 1952

Fabrikgebäude Van Delden in Ochtrup, ehemals Verwaltungsgebäude der Gebrüder Laurenz Textilwerke, Ende des 19. Jhs. im Stil der Neo-Renaissance errichtet, März 2000
Auch in den 1920er Jahren wuchs die westmünsterländische Baumwollindustrie weiterhin schneller als die deutsche Baumwollindustrie insgesamt, da sie von dem Wegfall der elsass-lothringischen Konkurrenz besonders profitierte und kaum der englischen Konkurrenz unterlag, die sich zunehmend auf die Herstellung von feineren Qualitäten und von Kunstfaserprodukten konzentrierte, und da das Ruhrgebiet weiterhin eine hohe Nachfrage ausübte. Außerdem wurden seit den 1920er Jahren auf dem Binnenmarkt die Bettwäsche und die Arbeitsbekleidung, die solange wegen der Haltbarkeit zumeist aus Leinen oder Halbleinen hergestellt worden waren, allmählich durch robuste Baumwollstoffe ersetzt, auf deren Herstellung sich die Textilindustrie des Westmünsterlandes spezialisiert hatte. Im Jahre 1934 liefen bereits 24 v. H. der Baumwollspindeln und 21 v. H. der Baumwollwebstühle Deutschlands; damit stieg dieses Gebiet zur größten Baumwollregion des Deutschen Reiches auf.
Die naheliegende Entstehung von Wäsche- und Bekleidungsbetrieben beschränkte sich auf die Herstellung von Arbeitsbekleidung in Bocholt oder Küchenwäsche in Nordhorn, die in Abteilungen einzelner Textilbetriebe erfolgte. Auch die Gründung chemischer Betriebe blieb aus; andere Industriezweige wurden weder aus dem lokalen Handwerk, noch in Reaktion auf die Bedürfnisse bzw. Angebote der Landwirtschaft (Landmaschinenbau, Nahrungsmittelindustrie) gegründet. M. a. W. im 19. Jahrhundert und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein blieb das Westmünsterland eine Region, die wirtschaftlich durch die Landwirtschaft und die Baumwollindustrie geprägt wurde; im Jahre 1925 waren immer noch 52 v. H. der Beschäftigten in Industrie und Handwerk des Westmünsterlandes in der Textilindustrie tätig.
Die defizitäre Industrialisierung des Westmünsterlandes und die damit drohenden Probleme wurden durchaus gesehen. Hierfür genügte bereits ein Blick in die angrenzende Twente. Auch dort war die Baumwollindustrie, deren Produktionsprogramm dem des Westmünsterlandes glich, bis in die 1920er Jahre - wenn auch weniger rasch - expandiert. Zudem unterlag sie einer ungleich höheren Konkurrenz als die westmünsterländische Baumwollindustrie. Denn einerseits herrschte in den Niederlanden eine Kontinuität des Freihandels, die der englischen, französischen, belgischen und deutschen Konkurrenz einen relativ ungehinderten Zugang auf den niederländischen Markt ermöglichte. Andererseits wurden der Baumwollindustrie der Twente mit der Expansion und den entsprechenden Lohnsteigerungen in der westmünsterländischen Baumwollindustrie Arbeitskräfte entzogen und ein Zwang zu eigenen Lohnerhöhungen ausgeübt. Als schließlich in den 1920er Jahren die ostindischen Märkte, die der Baumwollindustrie der Twente lange Zeit einen sicheren Absatz geboten hatten, an die japanische Konkurrenz verloren gingen, verlangsamte sich das Wachstum der Spindel- und Webstuhlzahlen bis hin zur Stagnation, d. h. die Baumwollindustrie wurde in der Twente früher von der Strukturkrise erfasst als im Westmünsterland. Nicht zuletzt dank staatlicher Unterstützung begannen sich hier früher alternative Industrien, vor allem Maschinenbau-, Elektro-, Chemie-, Wäsche- und Bekleidungsindustrie, schließlich auch Dienstleistungsbetriebe anzusiedeln; die Ablösung der Dominanz der Textilindustrie verlief jedoch außerordentlich langsam. Da es der Textilindustrie des Westmünsterlandes jedoch im Unterschied zur Twente bis zum Ende der 1950er Jahre wirtschaftlich vergleichsweise gut ging, entstand weder aus der Region heraus ein Bedürfnis nach Diversifizierung noch sah die staatliche Wirtschafts- und Raumordnungspolitik eine unmittelbare Notwendigkeit zum Eingreifen.
Im Westmünsterland absorbierte die Expansion und Dominanz der Textilindustrie bis in die 1950er Jahre hinein zahlreiche Entwicklungskräfte. Im Jahre 1964 liefen mit knapp 1.400.000 Spindeln bzw. 32.000 Webstühlen immer noch 26 bzw. 25 v. H. der westdeutschen Baumwollmaschinerie in Westfalen, d. h. überwiegend im Westmünsterland. Die Region behauptete damit ihre in den 1920er/1930er Jahren errungene nationale Führungsstellung. Dahinter stand eine Politik der Textilveredlung, des Übergangs zu Baumwoll-Kunstfasermischungen und der Entwicklung von Markenartikeln.
Letztlich konnte sich jedoch auch die münsterländische Textilindustrie nicht der Konkurrenz der Billigimporte aus den Ländern der Dritten Welt und Osteuropas sowie dem seit dem Ende der 1950er Jahre erfolgenden Wandel der Bundesrepublik von einem Textilexport- zu einem -importland entziehen. Während ihre Beschäftigtenzahl in den 1950er Jahren durchschnittlich 60.000 betrug - damit stellte sie 17-18 v. H. der Industriebeschäftigten des Industrie- und Handelskammerbezirks Münster -, fiel sie bis zum Jahre 1970 auf 47.189 (14,5 v. H.), bis 1981 auf 24.776 (9,7 v. H.) und bis 1986 auf 20.049 (8,7 v. H.).
Die naheliegende Entstehung von Wäsche- und Bekleidungsbetrieben beschränkte sich auf die Herstellung von Arbeitsbekleidung in Bocholt oder Küchenwäsche in Nordhorn, die in Abteilungen einzelner Textilbetriebe erfolgte. Auch die Gründung chemischer Betriebe blieb aus; andere Industriezweige wurden weder aus dem lokalen Handwerk, noch in Reaktion auf die Bedürfnisse bzw. Angebote der Landwirtschaft (Landmaschinenbau, Nahrungsmittelindustrie) gegründet. M. a. W. im 19. Jahrhundert und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein blieb das Westmünsterland eine Region, die wirtschaftlich durch die Landwirtschaft und die Baumwollindustrie geprägt wurde; im Jahre 1925 waren immer noch 52 v. H. der Beschäftigten in Industrie und Handwerk des Westmünsterlandes in der Textilindustrie tätig.
Die defizitäre Industrialisierung des Westmünsterlandes und die damit drohenden Probleme wurden durchaus gesehen. Hierfür genügte bereits ein Blick in die angrenzende Twente. Auch dort war die Baumwollindustrie, deren Produktionsprogramm dem des Westmünsterlandes glich, bis in die 1920er Jahre - wenn auch weniger rasch - expandiert. Zudem unterlag sie einer ungleich höheren Konkurrenz als die westmünsterländische Baumwollindustrie. Denn einerseits herrschte in den Niederlanden eine Kontinuität des Freihandels, die der englischen, französischen, belgischen und deutschen Konkurrenz einen relativ ungehinderten Zugang auf den niederländischen Markt ermöglichte. Andererseits wurden der Baumwollindustrie der Twente mit der Expansion und den entsprechenden Lohnsteigerungen in der westmünsterländischen Baumwollindustrie Arbeitskräfte entzogen und ein Zwang zu eigenen Lohnerhöhungen ausgeübt. Als schließlich in den 1920er Jahren die ostindischen Märkte, die der Baumwollindustrie der Twente lange Zeit einen sicheren Absatz geboten hatten, an die japanische Konkurrenz verloren gingen, verlangsamte sich das Wachstum der Spindel- und Webstuhlzahlen bis hin zur Stagnation, d. h. die Baumwollindustrie wurde in der Twente früher von der Strukturkrise erfasst als im Westmünsterland. Nicht zuletzt dank staatlicher Unterstützung begannen sich hier früher alternative Industrien, vor allem Maschinenbau-, Elektro-, Chemie-, Wäsche- und Bekleidungsindustrie, schließlich auch Dienstleistungsbetriebe anzusiedeln; die Ablösung der Dominanz der Textilindustrie verlief jedoch außerordentlich langsam. Da es der Textilindustrie des Westmünsterlandes jedoch im Unterschied zur Twente bis zum Ende der 1950er Jahre wirtschaftlich vergleichsweise gut ging, entstand weder aus der Region heraus ein Bedürfnis nach Diversifizierung noch sah die staatliche Wirtschafts- und Raumordnungspolitik eine unmittelbare Notwendigkeit zum Eingreifen.
Im Westmünsterland absorbierte die Expansion und Dominanz der Textilindustrie bis in die 1950er Jahre hinein zahlreiche Entwicklungskräfte. Im Jahre 1964 liefen mit knapp 1.400.000 Spindeln bzw. 32.000 Webstühlen immer noch 26 bzw. 25 v. H. der westdeutschen Baumwollmaschinerie in Westfalen, d. h. überwiegend im Westmünsterland. Die Region behauptete damit ihre in den 1920er/1930er Jahren errungene nationale Führungsstellung. Dahinter stand eine Politik der Textilveredlung, des Übergangs zu Baumwoll-Kunstfasermischungen und der Entwicklung von Markenartikeln.
Letztlich konnte sich jedoch auch die münsterländische Textilindustrie nicht der Konkurrenz der Billigimporte aus den Ländern der Dritten Welt und Osteuropas sowie dem seit dem Ende der 1950er Jahre erfolgenden Wandel der Bundesrepublik von einem Textilexport- zu einem -importland entziehen. Während ihre Beschäftigtenzahl in den 1950er Jahren durchschnittlich 60.000 betrug - damit stellte sie 17-18 v. H. der Industriebeschäftigten des Industrie- und Handelskammerbezirks Münster -, fiel sie bis zum Jahre 1970 auf 47.189 (14,5 v. H.), bis 1981 auf 24.776 (9,7 v. H.) und bis 1986 auf 20.049 (8,7 v. H.).
Vor allem seit der Mitte der 1970er Jahre brach die westmünsterländische Baumwollindustrie wie auch die deutsche Textilindustrie insgesamt mit ihren einfachen Massenprodukten ein. Denn jetzt begann der Binnenmarkt, der 70-80 v. H. der regionalen Textilproduktion abnahm, sich zunehmend bei den Billiganbietern der Länder der Dritten Welt und Osteuropas einzudecken. Damit traten in der Textilindustrie des Westmünsterlandes die Probleme auf, die in anderen Textilregionen schon früher entstanden waren: eine preismäßig überlegene Konkurrenz und hohe Arbeitslosenraten. Das erstmals im Jahre 1974 zwischen den Entwicklungs- und den Industrieländern abgeschlossene Welttextilabkommen, das die Einführung hoher Schutzzölle verhinderte, dafür aber die sog. Billigeinfuhren in die Industrieländer begrenzte, verhinderte den Niedergang nicht, sondern verzögerte ihn nur.
Im Unterschied etwa zur Baumwollindustrie Lancashires, für die der Staat während der 1960er Jahre in einer ersten Runde Stillegungs- und Modernisierungsprämien auswarf und in einer zweiten Runde zwei große Chemiekonzerne zahlreiche Textilbetriebe aufkauften, stilllegten oder verschmolzen, um sich einen Abnehmerkreis für einen Teil ihrer Produktion zu erhalten, setzte die Baumwollindustrie des Westmünsterlandes, insbesondere van Delden, darauf, durch den Zusammenschluss zu Großbetrieben, die Forcierung der Massenproduktion und die Konzentration auf Chemiefasergarne und -stoffe die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Infolgedessen entstanden hier gegen Ende der 1960er Jahre mit den Firmen Geritt von Delden in Gronau, Schulte & Dieckhoff in Horstmar und Nino in Nordhorn drei der fünf größten Textilkonzerne der Bundesrepublik. [Bild 5] In der Folgezeit zeigte sich jedoch, dass die Hoffnung auf Größenwachstum als Krisenlösung eine Fehlspekulation war. Im Jahre 1972 brachen zuerst Schulte & Dieckhoff, 1978/1996 Povel und im Jahre 1980 - trotz staatlicher Hilfen - auch die van Delden Gruppe, die sich durch Aufkäufe zum größten deutschen Textilkonzern entwickelt hatte, zusammen. Angesichts der Bedeutung der Textilindustrie für das Westmünsterland bedeuteten diese Zusammenbrüche einen drastischen Prozess der Deindustrialisierung.
Die anderen Textilbetriebe konnten sich, soweit sie über Kapital oder Kreditwürdigkeit verfügten und die nachfolgende Unternehmergeneration zur Betriebsübernahme bereit war, nur durch die gegenteilige Strategie halten, d. h. durch die chemische Veredlung der Bekleidungsstoffe, die Spezialisierung auf höherwertige Heimtextilien (Teppiche, Gardinen, Möbel- und Dekorationsstoffe) oder technische Gewebe, die Angliederung von Bekleidungsabteilungen, eine kapitalintensive technologische Modernisierung, die Erhöhung des Exportanteils und die Reduzierung der Betriebsgrößen. Mit dieser drastischen Schrumpfung und Marktanpassung, also der Konzentration auf Nischen, die während der ersten Hälfte der 1980er Jahre aufgrund der hohen Bedeutung der Textilindustrie für die westmünsterländische Wirtschaft zu überproportional hohen Arbeitslosenraten im Vergleich zum nordrhein-westfälischen Durchschnitt führte, konnten sich Reste der einstmals dominierenden Textilindustrie halten. Die Diversifizierung der Industriestruktur, die im Westmünsterland seit den 1960er/1970er Jahren erfolgte, setzte weitgehend unabhängig von der Textilindustrie durch die Entstehung und Entwicklung von Maschinenbau-, Holz- und Kunststoff-, Bekleidungs- und Nahrungsmittelbetrieben ein. Sie konnten den Verlust der textilindustriellen Arbeitsplätze z. T. kompensieren.
Die anderen Textilbetriebe konnten sich, soweit sie über Kapital oder Kreditwürdigkeit verfügten und die nachfolgende Unternehmergeneration zur Betriebsübernahme bereit war, nur durch die gegenteilige Strategie halten, d. h. durch die chemische Veredlung der Bekleidungsstoffe, die Spezialisierung auf höherwertige Heimtextilien (Teppiche, Gardinen, Möbel- und Dekorationsstoffe) oder technische Gewebe, die Angliederung von Bekleidungsabteilungen, eine kapitalintensive technologische Modernisierung, die Erhöhung des Exportanteils und die Reduzierung der Betriebsgrößen. Mit dieser drastischen Schrumpfung und Marktanpassung, also der Konzentration auf Nischen, die während der ersten Hälfte der 1980er Jahre aufgrund der hohen Bedeutung der Textilindustrie für die westmünsterländische Wirtschaft zu überproportional hohen Arbeitslosenraten im Vergleich zum nordrhein-westfälischen Durchschnitt führte, konnten sich Reste der einstmals dominierenden Textilindustrie halten. Die Diversifizierung der Industriestruktur, die im Westmünsterland seit den 1960er/1970er Jahren erfolgte, setzte weitgehend unabhängig von der Textilindustrie durch die Entstehung und Entwicklung von Maschinenbau-, Holz- und Kunststoff-, Bekleidungs- und Nahrungsmittelbetrieben ein. Sie konnten den Verlust der textilindustriellen Arbeitsplätze z. T. kompensieren.

Spinnweberei F. A. Kümpers KG in Rheine, Prüfen der fertiggestellten Webwaren, 1952

Schienentrasse und Signalanlagen bei Borghorst mit Blick auf die Spinnerei Gebrüder Kock, Mai 1954

Textilwerke Van Delden & Co. in Gronau, um 1970
Zusammenfassung
Überblickt man abschließend noch einmal den Prozess der Textilindustrialisierung im Westmünsterland, so werden zunächst einmal ungünstige Ausgangsbedingungen deutlich: Eine Dominanz der Landwirtschaft mit einem nebenberuflich betriebenen Textilgewerbe und eine geringe Zahl kapitalkräftiger Kaufmanns-Unternehmer. Es bedurfte erst der Initiativen aus den Niederlanden, dann vor allem der Schutzzollpolitik des Deutschen Reiches und des Anschlusses an das Eisenbahnnetz, damit in den 1870er Jahren der industrielle Take-off beginnen konnte. Der anschließende, bis in die 1930er Jahre hinein andauernde, zollgeschützte Wachstumsprozess und die Konzentrierung auf die Herstellung einfacher und mittlerer Qualitäten auf der einen Seite sowie die Nähe zum riesigen Absatzmarkt des Ruhrgebietes auf der anderen Seite führten dazu, dass die Wachstumschancen der regional dominierenden Baumwollindustrie die Kapazitäten des Westmünsterlandes z.T. noch übertrafen. Der regionale Arbeitsmarkt wurde voll ausgereizt, zeitweise sogar überreizt: Dies zeigen die zwischen den 1880er und 1950er Jahren immer wieder auftauchenden Klagen über einen Arbeitskräftemangel, der weder durch einen zunehmenden Werkswohnungsbau, die Rekrutierung von Beschäftigten aus den Niederlanden noch durch die Aufnahme von Flüchtlingen beseitigt werden konnte. Hinzu kam, dass nach der Erschließung vor allem des westlichen Teils des Westmünsterlandes durch die Eisenbahn ein Teil der Männer in das Ruhrgebiet abwanderte oder pendelte, weil in der Montanindustrie höhere Löhne gezahlt wurden. Für die industriellen Diversifizierungen, die üblicherweise von der Textilindustrie ausgingen, und für industrielle Neuansiedlungen fehlte deshalb in der ersten und zweiten Industrialisierungsphase der Anreizfaktor eines übersetzten Arbeitsmarktes.
Darüber hinaus veranlassten die Wachstumschancen der Baumwollindustrie die entsprechenden Unternehmer, die innerhalb dieser Region die größte Kapitalkraft besaßen, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein und damit gegen den Entwicklungsverlauf der deutschen Baumwollindustrie zur Erweiterung ihrer Textilbetriebe oder zu entsprechenden Neugründungen. Ihre Diversifizierungsversuche beschränkten sich auf die Einführung der Juteverarbeitung und die Angliederung von Konfektionsabteilungen. Die Gründung von Betrieben anderer Branchen erfolgte nicht; für derartige Initiativen reichte das Unternehmer- und Kapitalpotential in dieser landwirtschaftlich-dörflich geprägten Region offenbar nicht aus. Die Textilunternehmer zeigten auch im Westmünsterland eine gleichsam zunftartige Selbstbeschränkung. Ebenso blieben aber auch auswärtige Initiativen zur Gewerbe- und Industrieansiedlung aus, die an die regionale Wirtschaft anknüpfen konnten, wie z. B. die Nahrungsmittel- bzw. Landmaschinenindustrie, oder die Aussiedlung bzw. Filialgründung von Betrieben anderer Branchen, die das niedrige Lohnniveau nutzen konnten. Dieses Ausbleiben erklärt sich wesentlich aus der Ausschöpfung des regionalen Arbeitsmarktes durch die Baumwollindustrie, der verkehrstechnischen Randlage der Region und vermutlich auch daraus, dass die einheimischen Kaufleute, die eine dominierende wirtschaftliche, soziale und politische Stellung in den westmünsterländischen Dörfern und Kleinstädten einnahmen, derartige Initiativen nicht gerade gefördert haben dürften, da sie der relativ gering entlohnten Textilarbeiterschaft Arbeitsmarktalternativen eröffnet hätten.
Darüber hinaus veranlassten die Wachstumschancen der Baumwollindustrie die entsprechenden Unternehmer, die innerhalb dieser Region die größte Kapitalkraft besaßen, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein und damit gegen den Entwicklungsverlauf der deutschen Baumwollindustrie zur Erweiterung ihrer Textilbetriebe oder zu entsprechenden Neugründungen. Ihre Diversifizierungsversuche beschränkten sich auf die Einführung der Juteverarbeitung und die Angliederung von Konfektionsabteilungen. Die Gründung von Betrieben anderer Branchen erfolgte nicht; für derartige Initiativen reichte das Unternehmer- und Kapitalpotential in dieser landwirtschaftlich-dörflich geprägten Region offenbar nicht aus. Die Textilunternehmer zeigten auch im Westmünsterland eine gleichsam zunftartige Selbstbeschränkung. Ebenso blieben aber auch auswärtige Initiativen zur Gewerbe- und Industrieansiedlung aus, die an die regionale Wirtschaft anknüpfen konnten, wie z. B. die Nahrungsmittel- bzw. Landmaschinenindustrie, oder die Aussiedlung bzw. Filialgründung von Betrieben anderer Branchen, die das niedrige Lohnniveau nutzen konnten. Dieses Ausbleiben erklärt sich wesentlich aus der Ausschöpfung des regionalen Arbeitsmarktes durch die Baumwollindustrie, der verkehrstechnischen Randlage der Region und vermutlich auch daraus, dass die einheimischen Kaufleute, die eine dominierende wirtschaftliche, soziale und politische Stellung in den westmünsterländischen Dörfern und Kleinstädten einnahmen, derartige Initiativen nicht gerade gefördert haben dürften, da sie der relativ gering entlohnten Textilarbeiterschaft Arbeitsmarktalternativen eröffnet hätten.
Hinzu kam schließlich der Spätstart der Textilindustrialisierung in diesem Raum. Denn die typischen Diversifizierungschancen einer lokalen und regionalen Wirtschaft, deren Industrialisierung im Textilgewerbe begann, nämlich der Aufbau einer Maschinenbau-, Wäsche- und Bekleidungs- oder einer chemischen Industrie, waren in den 1870er Jahren bereits in anderen Regionen weitgehend realisiert. D. h. die Standorte dieser, aber auch anderer Industrien hatten sich bereits herausgebildet, und die Absatzmärkte waren vielfach verteilt, so dass es im Westmünsterland für neue Betriebe und Branchen trotz der regionalen Koppelungsmöglichkeiten schwerer war, sich zur Mitte als zu Beginn der ersten Industrialisierungsphase zu etablieren. Die fehlende Diversifizierung der Industrie im Westmünsterland erklärt schließlich auch, dass wesentliche Voraussetzungen für die Entfaltung des Dienstleistungsgewerbes und für einen Urbanisierungsprozess gering blieben.

Luftbild des Geländes der Landesgartenschau (Laga Gronau/Losser) in Gronau, errichtet auf dem Areal einer z. T. abgebrochenen Textilfabrik, 2003
Ressourcen zum Thema
Informationstexte im Internet-Portal
Quelle
Externe Ressourcen
Literatur
- Zum Thema bietet das Internet-Portal vielfältige weitere Ressourcen an:
 Westfalen 1850-1899 |
Westfalen 1850-1899 |  Wirtschaft
Wirtschaft  Christian Jansen / Susanne Rouette: Zwischen Revolution und Reichsgründung. Westfalen auf dem Weg in eine moderne Gesellschaft (1850-1870)
Christian Jansen / Susanne Rouette: Zwischen Revolution und Reichsgründung. Westfalen auf dem Weg in eine moderne Gesellschaft (1850-1870) Hans-Joachim Behr: Westfalen im Kaiserreich bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs (1871-1914)
Hans-Joachim Behr: Westfalen im Kaiserreich bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs (1871-1914) Karl Ditt: Westfalens Wirtschaft im 20. Jahrhundert - Vom Vorreiter zum Nachzügler
Karl Ditt: Westfalens Wirtschaft im 20. Jahrhundert - Vom Vorreiter zum Nachzügler Karl Ditt: 17. August 1850 - Gründung der Spinnerei Vorwärts in Bielefeld
Karl Ditt: 17. August 1850 - Gründung der Spinnerei Vorwärts in Bielefeld Anke Asfur: Wirtschaftlicher Strukturwandel und Herausbildung von 'Global Playern' in Westfalen im 19. und 20. Jahrhundert (Quellenedition)
Anke Asfur: Wirtschaftlicher Strukturwandel und Herausbildung von 'Global Playern' in Westfalen im 19. und 20. Jahrhundert (Quellenedition)
Quelle
- Deutsches Kaiserreich:
 "Gesetz betreffend den Zolltarif des Deutschen Zollgebiets und den Ertrag der Zölle und der Tabacksteuer", 15.07.1879
"Gesetz betreffend den Zolltarif des Deutschen Zollgebiets und den Ertrag der Zölle und der Tabacksteuer", 15.07.1879
Externe Ressourcen
Literatur
- Adelmann, G.: Vom Gewerbe zur Industrie im kontinentalen Nordwesteuropa. Gesammelte Aufsätze zur regionalen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Stuttgart 1986.
- Bauer, H.-J.: Die deutsche Baumwollindustrie in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und ihre Struktur und Wettbewerbsfähigkeit sowie ihre wirtschaftspolitische Behandlung, Diss. Mannheim 1968.
- Bieling, A.: Probleme der Arbeitsstruktur und des Arbeitseinsatzes im münsterländischen Textilgebiet, Münster 1940.
- Biller, C.: Der Rückgang der Hand-Leinwandindustrie des Münsterlandes, Leipzig 1906.
- Blumberg, H.: Die deutsche Textilindustrie in der industriellen Revolution, Berlin 1965.
- Boot, J. A. P. G. / Blonk, A.: Van smiet - tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw, Hengelo 1957.
- Boot, J. A. P. G.: De Twentsche Katoennijverheid 1830-1973, Amsterdam 1935.
- Breitenacher, M.: Textilindustrie. Strukturwandel und Entwicklungsperspektiven für die 80er Jahre, Berlin 1981.
- Breitenacher, M. / Gälli, A./Gretermann, K.: Perspektiven des Welttextilhandels. Optionen der Erneuerung des Welttextilabkommens aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland, Südkoreas und Brasiliens, München 1986.
- Breitenacher, M.: Die Textilindustrie in der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1983.
- Brinkhaus, H. J. / Casser, P.: Vom Werden und Wachsen der Brinkhaus Inlett Weberei, Warendorf 1951.
- Buchholz-Will, W. u.a.: Krisenanpassung und Arbeitsbedingungen in der nordrhein-westfälischen Textil- und Bekleidungsindustrie, in: Jahrbuch Arbeit und Technik in Nordrhein-Westfalen 1985, S. 281-294.
- Butke, I.: Zur Entwicklung der Textilindustrie in der Grafschaft Bentheim, Diss. Münster 1939, Emsdetten 1939.
- Casser, P.: 1854-1954. Gebr. Laurenz Ochtrup. Werden und Wirken in hundert Jahren, Bielefeld o. J. (1954).
- Casser, P.: Leinen aus Nordwalde. Eine Festgabe für Ludwig Fraling, Münster 1960.
- Gerrit Van Delden & Co., Gronau, Kreis Ahaus, in: J. Heil (Hg.): Die westdeutsche Wirtschaft und ihre führenden Männer. Land: Nordrhein-Westfalen, Teil I: Ostwestfalen/Lippe und Münsterland, Oberursel 1969, S. 97-102.
- Delden, H. van: Der Konzentrationsprozeß in der Textilindustrie - unternehmensstrategische und technologische Bedingungen für seine Entfaltung, in: Zeitschrift für allgemeine und textile Marktwirtschaft 1973, Heft 1, S. 61-78.
- Ditt, K.: Münster und die Textilindustrialisierung im Münsterland während des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Helene Albers/Ulrich Pfister (Hg.), Industrie in Münster 1870-1970. Lokale Rahmenbedingungen - Unternehmensstrategien - regionaler Kontext, Dortmund 2001, S. 314-337.
- Ditt, K.: Vorreiter und Nachzügler in der Textilindustrialisierung. Das Vereinigte Königreich und Deutschland während des 19. Jahrhunderts im Vergleich, in: H. Berghoff/D. Ziegler (Hg.): Pionier und Nachzügler? Vergleichende Studien zur Geschichte Großbritanniens und Deutschlands im Zeitalter der Industrialisierung. Festschrift für Sidney Pollard zum 70. Geburtstag, Bochum 1995, S. 29-58.
- Ditt, K.: Wirtschaftlicher Wandel in Textilregionen während des 19. und 20. Jahrhunderts: Die Industrialisierung Minden-Ravensbergs und des Westmünsterlandes im Vergleich, in: Westfälische Forschungen 50 (2000), S. 293-331.
- Ditt, K.: The Rise and Fall of the German Linen Industry in the 19th and 20th Centuries, in: B. Collins/P. Ollerenshaw The European Linen Industry in Historical Perspective, Oxford 2003, S. 259-283.
- Döhrmann, K.: Die Entstehung der Gronauer Textilindustrie und ihre Entwicklung, Diss. Köln 1924.
- Drewe, P.: Großräumige Monostrukturen im Raum Twente - Oost Gelderland – Westmünsterland, in: Monostrukturierte Räume. Problemanalyse und Entwicklungsprognose, Münster 1970, S. 66-86.
- Fabian, F.: Der Konzentrationsprozeß in der britischen Textilindustrie, in: W. G. Hoffmann u.a.: Textilwirtschaft im Strukturwandel, Tübingen 1966, S. 81-119.
- Fabian, F.: Produktionstechnischer Fortschritt, Mindestbetriebsgröße und Konzentration in der Textilindustrie untersucht am Beispiel der westdeutschen Baumwollspinnerei und -weberei, Münster 1969.
- Fischer, E. J. / Veen, D. J. van der: Gids voor de bestudering van de Geschiedenis der Twentse Katoenindustrie tussen 1800 en 1940, in: Textielhistorische Bijdragen 23 (1982), S. 70-103.
- Fischer, E. J.: De ontwikkeling van de Twentse katoenindustrie en de toename van de arbeidsproduktiviteit tussen 1800 en 1830, in: Textielhistorische Bijdragen 22 (1981), S. 1-38.
- Fischer, E. J.: Fabriquers en Fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S. J. Spanjaard te Borne tussen circa 1880 en 1930, Utrecht 1983.
- Gesellschaft für Regionale Strukturentwicklung e.V. / Stichting Het Nederlands Economisch Instituut: Strukturuntersuchung Twente-Oost-Gelderland. Westmünsterland-Grafschaft Bentheim, 2 Bde., Bonn/Rotterdam 1971.
- Gladen, A.: Der Kreis Tecklenburg an der Schwelle des Zeitalters der Industrialisierung, Münster 1970.
- Gröter, K.: Die deutsche Juteindustrie, Diss. Münster 1912.
- Hauff, T.: Der Einfluß von Aufstieg und Niedergang der "Delden-Textilgruppe" auf die Stadt Gronau/Westfalen, in: Westfälische Forschungen 41 (1991), S. 187-219.
- Helmrich, W.: Die Industrialisierung und wirtschaftliche Verflechtung des Münsterlandes, Münster 1937.
- Hövel, L.: 100 Jahre Grevener Baumwoll-Spinnerei, Münster 1955.
- Jacobs, G.: Die deutschen Textilzölle im 19. Jahrhundert, Diss. Erlangen 1907.
- Fünfzig Jahre im Dienste des Familienunternehmens C. u. F. Fraling, Münster o. J. [1960].
- Kersting, A.: Das Textilindustriegebiet des westfälisch-niederländischen Grenzbezirks. Entwicklung und Probleme des "Baumwollgebietes Rhein-Ems", in: Westfälische Forschungen 11 (1958), S. 86-105.
- Kertesz, A.: Die Textilindustrie sämtlicher Staaten, Braunschweig 1917.
- Kirchhain, G.: Das Wachstum der deutschen Baumwollindustrie im 19. Jahrhundert. Eine historische Modellstudie zur empirischen Wachstumsforschung, Diss. Münster 1973.
- Klaassen, L. H.: De Functie van Twente in de Nederlandse Economie met Beschouwingen betreffende Oost Gelderland en Westmünsterland, Rotterdam 1968.
- Von Klaß, G.: 80 Jahre Ludw. Povel & Co. 1872-1952. Bunt-Spinnerei und Weberei, Ausrüstung. Nordhorn, Grafschaft Bentheim, o.O. o.J. [1952].
- Kötter, H.: Die Textilindustrie des deutsch-niederländischen Grenzgebietes in ihrer wirtschaftsgeographischen Verflechtung, Bonn 1952.
- Kouwe, P. J. W.: Die Raumsituation des deutsch-niederländischen Textilgebiets unter dem Gesichtspunkt des gemeinsamen Europäischen Marktes, in: Westfälische Forschungen 11 (1958), S. 105-111.
- Kuhn, W.: Technische Denkmale der Textilindustrie Gronaus unter besonderer Berücksichtigung ihrer sozio-ökonomischen Umgebung 1854-1924, Diss. Bochum 1977.
- Kuntze, K.: Die Baumwollindustrie, in: Das Handwörterbuch der Wirtschaftskunde Deutschlands, Bd. 3, Leipzig 1904, S. 580-621.
- Lassotta, A. / Lutum-Lenger, P. (Hg.): Textilarbeiter und Textilindustrie. Beiträge zur ihrer Geschichte in Westfalen während der Industrialisierung, Hagen 1989.
- Liffers, H.: Bocholt und seine Industrie, Trautheim 1951.
- Lindenberg, A.: Bocholt wird Industriestadt. Die Entwicklung der mechanischen Spinnerei und Weberei 1850-1900, in: Unser Bocholt. Zeitschrift für Kultur- und Heimatpflege 11 (1960), S. 25-33.
- Lochmüller, W.: Zur Entwicklung der Baumwollindustrie in Deutschland, Jena 1906.
- Muthesius, V.: 100 Jahre M. van Delden & Co. 1854-1954 o. O. o. J. [1954].
- Neundörfer, K.: Krisen in der Textilindustrie der Bundesrepublik Deutschland, in: Henning, F.-W. (Hg.): Krisen und Krisenbewältigung vom 19. Jahrhundert bis heute, Frankfurt 1998, S. 29-48.
- Reichs-Enquete für die Baumwoll- und Leinen-Industrie. Stenographische Protokolle über die mündliche Vernehmung der Sachverständigen, Berlin 1879.
- Rauert, M. H.: Spinnweber und "Sportkameraden". Die paternalistische Lebenswelt der Baumwollindustrie am Beispiel der Kümpers-Firmen in Rheine/Westfalen 1834-1955, Hamburg 1997.
- Rödlich, Friedrich H.: Von der Bleicherei zur Textilchemie. Strukturwandlungen der Textilveredlung seit 1945, dargestellt am Beispiel des Westmünsterlandes, Frankfurt 1998.
- Rothe, W.: Standort und Struktur der Baumwollindustrie in den EWG-Staaten, Köln/Opladen 1968.
- Schoor, W.: Textilindustrielle Kraftzentren in Rheinland-Westfalen, Essen 1941.
- Schröter, H.: Handel, Gewerbe und Industrie im Landdrosteibezirk Osnabrück 1815-1866, in: Osnabrücker Mitteilungen 68 (1959), S. 309-358.
- Schüling, H.: Die Entwicklung der Bocholter Textilindustrie, in: Münsterland 1922, S. 241-257.
- Schüren, R.: Heimgewerbliche Bevölkerung und Textilarbeiterschaft im deutsch-niederländischen Grenzraum (Westmünsterland/Twente) vor 1860, in: K. Ditt/S. Pollard (Hg.): Von der Heimarbeit in die Fabrik. Industrialisierung und Arbeiterschaft in Leinen- und Baumwollregionen Westeuropas während des 18. und 19. Jahrhunderts, Paderborn 1992, S. 430-448.
- Schüren, R.: Staat und ländliche Industrialisierung. Sozialer Wandel in zwei Dörfern einer deutsch-niederländischen Textilgewerberegion 1830-1914, Dortmund 1985.
- Schüren, R.: Die Wurzeln der Textilindustrie im westlichen Münsterland, in: Spindel und Schiffchen 50, Nr. 1 (1986), S. 7-18.
- Schwabe, U.: Textilindustrie in der Grafschaft Bentheim 180-1914, Sögel 2008.
- Simonetti, T.: Die Entwicklung der Baumwollindustrie des Münsterlandes im 19. Jahrhundert und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, Diss. Münster o. J.
- Stroink, L. A.: Stad en Land van Twente, Enschede 1962.
- Terhalle, H.: Entwicklung des Kreises Borken im 19. und 20. Jahrhundert. In: Der Kreis Borken, hg. v. Kreis Borken, Stuttgart 1982.
- Teuteberg, H. J. (Hg.): Die westmünsterländische Textilindustrie und ihre Unternehmer, Münster 1996.
- Teuteberg, H. J.: Vom Agrar- zum Industriestaat (1850-1914), in: W. Kohl (Hg.): Westfälische Geschichte, Bd. 3: Das 19. und das 20. Jahrhundert. Wirtschaft und Gesellschaft, Düsseldorf 1984, S. 163-311.
- Thormählen, G.: Die Großunternehmen der westdeutschen Textilindustrie im Strukturwandel, Diss. Hamburg 1978.
- Tradition eines Familienunternehmers in fünf Generationen 1835-1960. Hg. anlässlich des 125jährigen Bestehens der Baumwoll-Spinnerei und Weberei C. Kümpers & Timmermann, Rheine o.O.u.J.
- Warnecke, H. J.: Von der Hausweberei zur Textilindustrie, in: 968-1968. 1000 Jahre Borghorst, hg. v. d. Stadt Borghorst (W. Kohl), Münster 1968, S. 77-89.
- Webb, S.: Tariff Protection for the Iron Industry, Cotton Textiles, and Agriculture in Germany, 1879-1914, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 192 (1977), S. 336-357.
- Westerhoff, E.: Die Bocholter Textilindustrie. Unternehmen und Unternehmer, 2. Aufl., Bocholt 1984.
- Wiegmann, K.: Textilindustrie und Staat in Westfalen 1914-1933, Stuttgart 1993.
- Wischermann, C.: An der Schwelle zur Industrialisierung (1800-1850), in: W. Kohl (Hg.): Westfälische Geschichte, Bd. 3: Das 19. und das 20. Jahrhundert. Wirtschaft und Gesellschaft, Düsseldorf 1984, S. 41-162.
- Wischermann, C.: Vom Heimgewerbe zur Fabrik. Industrialisierung und Aufstieg der Nordhorner Textilindustrie im 19. und 20. Jahrhundert, in: Nordhorn. Beiträge zur 600jährigen Stadtgeschichte. Im Auftrag der Stadt Nordhorn hg. v. C. von Looz-Corswarem / M. Schmitt, Nordhorn 1979, S. 190-228.
- Wischermann, C.: Zur Problematik regionaler historischer Wirtschaftskarten am Beispiel des westfälischen Textilgewerbes, in: H.-J. Teuteberg (Hg.): Westfalens Wirtschaft am Beginn des Maschinenzeitalters, Dortmund 1988, S. 157-170.
- Wischermann, C.: Die Industrialisierung des Baumwollgewerbes in Westfalen, in: K. Ditt/S. Pollard (Hg.): Von der Heimarbeit in die Fabrik. Industrialisierung und Arbeiterschaft in Leinen- und Baumwollregionen Westeuropas während des 18. und 19. Jahrhunderts, Paderborn 1992, S. 192-223.
- Wunden, W.: Die Textilindustrie der Bundesrepublik Deutschland im Strukturwandel, Basel 1969.
- Wurst, A.: 75 Jahre Industrie- und Handelskammer zu Münster i. W. Festschrift zum 75jährigen Bestehen der Industrie- und Handelskammer. Industrie und Handel des Bezirks von 1854 bis 1929, Münster 1929.
Der Autor | Dr. Karl Ditt, Historiker, Wissenschaftlicher Referent für Arbeitergeschichte am LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster, karl.ditt@lwl.org
Zitation | Karl Ditt, 15. Juli 1879 - Das Schutzzollgesetz und seine Konsequenzen für die münsterländische Baumwollindustrie, in: Internet-Portal "Westfälische Geschichte", URL: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/ku.php?tab=que&ID=618 (letzte Überprüfung: [Datum des letzten Aufrufs]).
Zitation | Karl Ditt, 15. Juli 1879 - Das Schutzzollgesetz und seine Konsequenzen für die münsterländische Baumwollindustrie, in: Internet-Portal "Westfälische Geschichte", URL: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/ku.php?tab=que&ID=618 (letzte Überprüfung: [Datum des letzten Aufrufs]).






 Aufrufe gesamt: 15717
Aufrufe gesamt: 15717