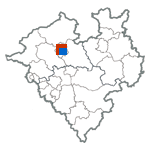| Bestand |
 Urkunden Urkunden
|
 Regestenliste
| Regestenliste
|  Suche
im Bestand Suche
im Bestand
|
| Bestandsignatur |
Clerus secundarius - Urkunden |
| Findbuch |
B 201u |
| Umfang |
46 Urkunden |
| Laufzeit |
1429-1777 |
| Inhalt |
Der Fall Johannes von Aachen
Ein vom Domstift zu Münster ausgehender, die Grenzen der Stadt und des Fürstbistums letztlich weit überschreitender Konflikt stellt der Fall des Osnabrücker Observanten Johannes von Aachen (ca. 1572) dar. Er wurde zum Ausgangspunkt eines länger anhaltenden Streits um die Ausübung der Jurisdiktion zwischen Stadt, Bischof und Klerus hinsichtlich straffällig gewordener geistlicher Personen. Mit insgesamt neun Urkunden findet diese Auseinandersetzung auch ihren Niederschlag in dem vorliegenden Bestand.
1537 übernahm der Minorit Johannes von Aachen (auch Johannes Aquensis, Johann van Aken) das Amt des ersten Dompredigers nach den Täuferunruhen. In seiner 1573 geschriebenen "Wiedertäufergeschichte" nennt Hermann von Kerssenbrock, langjähriger Rektor der Domschule, Johannes von Aachen als zweiten Mathematicus, der an der Münsteraner Domuhr (1540-1542) mitgearbeitet hat (Detmer 1900, S. 42; Wieschebrink 1968, S. 10). Der Domprediger genoss im münsterschen Domkapitel hohes Ansehen. Dies wird auch daraus ersichtlich, dass der gelehrte Domdechant Rotger Korff, genannnt Schmising, ihm in seinem Testament von 1547 aus seiner Bibliothek die Werke des Erasmus von Rotterdam vermachte (Germania Sacra NF 17,2, S. 107). Zugleich galt der Domprediger allerdings als ein Mann, der "den hoiken na dem winde holden konde" (Schröer 1983, S. 473). Nach dem Tod des Johann Bischopinck wurde Johannes von Aachen durch das Kapitel zum neuen Weihbischof designiert. Obwohl seine Sympathien zunächst dem Osnabrücker Reformator Hermann Bonnus galten, mit dem Johannes 1543 in Iburg eine Disputation über die Kirchenreformation geführt hatte (Spiegel 1892, S. 93ff.), erschien Bischof  Franz von Waldeck mit Johannes von Aachen als designiertem Weihbischof auf der Bistumssynode vom 15.10.1548 (Schwarz 1913, S. 233f.). Im Synodaldekret vom 19.10.1548 ordnete er eine den kanonischen Satzungen entsprechende allgemeine kirchliche Reformation an. Ein zusätzliches Mandat verbot das Konkubinat der Geistlichen (Germania Sacra, NF 37,1, S. 516; Behr 1996, S. 427). Franz von Waldeck mit Johannes von Aachen als designiertem Weihbischof auf der Bistumssynode vom 15.10.1548 (Schwarz 1913, S. 233f.). Im Synodaldekret vom 19.10.1548 ordnete er eine den kanonischen Satzungen entsprechende allgemeine kirchliche Reformation an. Ein zusätzliches Mandat verbot das Konkubinat der Geistlichen (Germania Sacra, NF 37,1, S. 516; Behr 1996, S. 427).
Um eben diese Zeit wurden dem Domprediger und designierten Weihbischof ehebrecherische Beziehungen zu einer Bürgerin, der Frau des Lubbert von Schuttrup, vorgeworfen (Janssen 1856, S. 6). Der Stadtrat von Münster ließ Johannes von Aachen im Gefängnis am Mauritztor inhaftieren. Wegen Verletzung der geistlichen Immunität strengte das Domkapitel vor dem Bischof einen Prozess gegen die Stadt an. Als dieser zugunsten des Domkapitels entschied, rief die Stadt den Kölner Erzbischof Adolf von Schaumburg an. Auch dieser gab der Stadt einen abschlägigen Bescheid. Schließlich entschied auch ein vom Papst delegierter Richter im September 1550 gegen die Stadt. Auf Grund der Fürsprache des Paderborner Bischofs Rembert von Kerssenbrock und Herzog Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg wurde Johannes von Aachen wieder auf freien Fuß gesetzt. Schuld oder Nichtschuld blieben weiterhin ungeklärt; seine Einsetzung als Weihbischof war auf diese Weise jedenfalls verhindert worden. Das Verfahren entwickelte sich in der Folge zu einer generellen Streitsache hinsichtlich der Gerichtsbarkeit der Stadt gegenüber straffällig gewordenen Klerikern (Behr 1996, S. 439, Germania Sacra, NF 37,4, S. 40f., Hamelmann 1913, S. 50ff.). Der Prozess zog sich über beinahe zehn Jahre hin und wurde schließlich, im August 1558, durch einen Vergleich beigelegt (s. u. Ergänzungsüberlieferung).
Die im Bestand befindlichen Urkunden Nr. 5 bis 13, alle aus dem Jahr 1555, dokumentieren einen Ausschnitt dieser Verhandlungen: Mitglieder des Clerus secundarius übertragen, teils durch selbst ausgestellte Urkunden, teils unter Hinzuziehung eines Notars, dem Kölner Fiskal Tilmann Rinsche die Vollmacht, sie bei gerichtlichen Verhandlungen mit dem Rat der Stadt Münster zu vertreten. Eine Ausnahme stellt hier die Urkunde Nr. 7 dar; aus einem nicht ersichtlichen Grund bestellte das Kollegiatstift Horstmar einen anderen Prokurator als den Kölner Fiskal Rinsche. Die Urkunden nehmen ausdrücklich Bezug auf die Verurteilung und Inhaftierung des Dompredigers Johannes von Aachen durch den münsterischen Magistrat im Jahr 1548. Die Rechtsstreitigkeiten sollten jeweils vor dem kommissarisch eingesetzten Richter Konrad Orth ab Hagen (1523-1589) ausgetragen werden. Konrad Orth ab Hagen stammte aus Geseke und war der Sohn des dortigen Bürgermeisters Liborius Orth und dessen Ehefrau Sibylla ab Hagen. Er studierte - unter der Obhut seines Onkels Bernhard ab Hagen, kurfürstlicher Kanzler des Kölner Erzbischofs - Rechtswissenschaften und Theologie in Köln, wo er selbst später Rektor an der Universität sowie Dechant und Kanonikus an der Stiftskirche St. Georg wurde.
An Hand der in den Bestand gelangten Urkunden lassen sich folgende Institutionen belegen, die an der Ernennung des Tilmann Rische beteiligt waren: die Kollegiatskirche St. Felicitas in Vreden (Urk. 5), die Stiftskirche St. Sebastian in Beckum (Urk. 6), das Kollegiatstift St. Remigius in Borken (Urk. 8), das Kollegiatstift St. Viktor in Dülmen (Urk. 9), die Pfarrkirche St. Aegidii in Münster (Urk. 10), das Dekanat Liebfrauen-Überwasser in Münster (Urk. 10), das Dekanat St. Lamberti in Münster (Urk. 10), das Adlige Frauenstift Liebfrauen-Überwasser in Münster (Urk. 11), das Damenstift St. Johannes in Langenhorst (Urk. 12) und das Karthäuserkloster Marienburg in Weddern (Urk. 13).
Erstaunlich bleibt, dass es sich hierbei überwiegend um Zeugnisse des Clerus extraneus handelt, und sich keine weiteren Urkunden über die Ernennung Tilmann Rinsches im Bestand finden. Es fehlen diejenigen der münsterischen Kollegiatstifte (intraneum), die doch den Clerus secundarius eigentlich repräsentierten. Hinsichtlich dieser Institutionen wäre eine gemeinsame Erklärung mit dem übergeordneten Kollegiatstift zum Alten Dom St. Pauli zu erwarten gewesen. Somit fehlt nicht zuletzt die Ernennung des Prokurators Rinsche durch den Dechanten des Stifts Alter Dom (decanus minor genannt, im Gegensatz zu dem decanus maior des Domstifts), der gewöhnlich als Sprecher des Sekundarklerus (orator cleri secundarii, kurz os cleri) fungierte (eine solche gemeinsame Erklärung der genannten Kollegiatstifte, freilich in einem anderen Zusammenhang, stellt z. B. die Nr. Urkunde 23 dar). Übrigens existiert eine entsprechende Urkunde auch nicht im Bestand Stift Alter Dom. Diese Lücke in der Überlieferung könnte darauf hindeuten, dass der Sekundarklerus als Handlungsgemeinschaft locker organisiert und nicht zu gemeinsamem Handeln gezwungen war.
Ergänzungsüberlieferungen zum Fall Johannes von Aachen sowie zu dem sich anschließenden Einigungsprozess finden sich im Bestand Domkapitel Münster, Akten Nr. 2425. Diese Akte enthält Schriftstücke aus den Jahren 1549 bis 1558, darunter Schreiben des Fürstbischofs von Münster Wilhelm Ketteler, des durch den Klerus bestellten Prokurators Tilmann Rinsche (vom 15.03.1555), dem zum Richter berufenen Konrad Orth ab Hagen sowie zahlreiche Schriftstücke des Kölner Theologen und Juristen Goddert (Gottfried) Gropper, von dem sich offenbar das Domkapitel Münster vertreten ließ. Daneben findet sich hier die Kopie des Vertrags zwischen dem Bischof Bernhard von Raesfeld, dem Domkapitel und weiteren Klerus einer- und dem Rat der Stadt Münster andererseits. In diesem Vertrag vom 13.08.1558 wird das Ergreifen der Geistlichen, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben, vorläufig geregelt (s. a. Clerus secundarius Akten, Nr. 4, pp. 20-23). Der Vertrag erhielt seine Bestätigung durch Kaiser Ferdinand I. allerdings erst im Dezember 1562.
Des Weiteren weist auch die Überlieferung des Stadtarchivs Münster auf die Streitigkeiten über die Ausübung weltlicher und geistlicher Gerichtsbarkeit in Folge der Verhaftung des Johannes von Aachen hin. Im Ratsarchiv sind die Auseinandersetzungen zwischen Bischof, Klerus und Stadtrat ab 1548 ausführlich dokumentiert (siehe Archive der Fürstbischöflichen Zeit, Ratsarchiv, Jurisdiktion (A V), Findbuch A-RatsA: Ratsarchiv). Hier findet sich auch die Ernennung von Rembert von Kerssenbrock und Herzog Wilhelm von Kleve als Vermittler zwischen Stadt und Bischof durch Kaiser Karl V. (A V d Nr. 2). Aus einem Bericht des seitens der Stadt Münster beauftragten Lizentiaten Jorg Schorre an Bürgermeister und Rat geht hervor, dass der Fall des Johannes von Aachen und der sich daran anschließende Streit über die Jurisdiktion von April bis Juni 1551 beim Reichskammergericht in Augsburg verhandelt wurde (A V d Nr. 3a, 3c). 1556 ernannte die Stadt dann Casper Fischardt zu ihrem Rechtsvertreter (Nr. 4). |
| Anmerkungen |
Urkundenbestände des Domkapitels Münster in DWUD: Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen,  Domkapitel Münster, und Bistumsarchiv Münster, Domkapitel Münster, und Bistumsarchiv Münster,  Domarchiv (Domkapitel Münster), Altes Archiv. Domarchiv (Domkapitel Münster), Altes Archiv.
Ergänzungsüberlieferung.
- Münster, Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen. Fürstbistum Münster, Landesarchiv, Akten, Band 1, Abt. 51-58, 31-34. - Domkapitel Münster. - Alter Dom. |
| Information |
Der Bestand beinhaltet die urkundliche Überlieferung des Clerus secundarius. Die Abschrift eines von Adolf III. von der Mark am 15.01.1359 ausgestellten Privilegs über das freie Verfügungsrecht des münsterschen Clerus secundarius über seine Nachlässe (Nachlass Johann Gerhard von Druffel, Nr. 151 a) ist das älteste Dokument zum Sekundarklerus, das sich in den Beständen der Abteilung Westfalen nachweisen lässt.
Die Geschichte des Archivs des Clerus secundarius ist schwer rekonstruierbar. Nach Hansen 1890, S. 32 (Anm. 2) ist das Archiv mit einer für den Sekundarklerus im Jahr 1451 angefertigten Abschrift des Privilegiums Kaiser Karls IV. über die kirchlichen Freiheiten der Geistlichen der Diözesen Osnabrück und Münster unter Einbeziehung weiterer Privilegien und Urkunden begründet worden. Es wurde - ebenso wie das Archiv des Kapitels - in der Sakristei des Alten Doms aufbewahrt (vgl. Germania Sacra, NF 33,6, S. 33-36; Urk. 21). Die Verwaltung beider Archive oblag dem Dechanten, bzw. Praeses des Sekundarklerus, der im Zuge der Säkularisation ab 1802 beide Archive mehrmals entsiegeln ließ, um Urkunden (v. a. Obligationen) zu entnehmen (vgl. Kriegs- und Domänenkammer Münster Fach 19, Nr. 131). Schon im 18. Jh. wurde das Archiv mehrfach überprüft und verzeichnet: 1716 wurde es thematisch getrennt in zwei Truhen aufbewahrt. Im Zuge einer weiteren Inventarisierung aus dem Jahr 1750 wird noch von der gleichen Aufteilung berichtet (Clerus secundarius Akten Nr. 18).
Seit 1805, nachdem der Dom zwecks Umwandlung in ein Kriegsmagazin geräumt werden musste, lagerte das Archiv des Sekundarklerus, dessen Umfang nun einen Schrank (Germania Sacra, NF 33,6, S. 34) umfasste, im Nordturm der Domkirche. Ein Jahr später wurde die Aufsicht über das Archiv von der Kriegs- und Domänenkammer dem Domdechanten Jodocus Hermann Joseph Zurmühlen und seinem Bruder, dem Domkellner, übertragen. Nach der Auflösung des Domstifts begab sich der Munizipalrat Vagedes am 17.03.1812 u. a. in Begleitung des Domänenrentmeisters Franz Friedrich Geisberg, der Gebrüder Zurmühlen und des Archivars des Lippe-Departements, Ferdinand Kersten, in den Nordturm des Doms, um das aus insgesamt acht versiegelten Schränken, Kisten und Koffern bestehende Archiv des Alten Domstifts zu sichten. Kersten wurde beauftragt, die sich in einem der Schränke und einer Kiste befindlichen Urkunden, Obligationen und Nachrichten der Cleri Secundarii zu inventarisieren. (Alter Dom Münster VI Nr. 24).
Überliefert ist von Kerstens Inventarisierung eine Aufstellung der Briefschaften des Sekundarklerus mit dem Vermerk, dass von den Urkunden und Nachrichten nur zwei Dokumente vorhanden gewesen seien, darunter eine Abschrift des Rezess über die beschwerlichen Dienste der Eigenhörigen des Clerus secundarius vom 13.09.1578 (heute vermutlich Bestand Clerus secundarius Akten, Nr. 4). Neben den Briefschaften, die sich über den Zeitraum von 1610 bis 1802 erstrecken, verzeichnete Kersten auch das Rapiarium über die Zusammenkünfte des Sekundarklerus von 1762 bis 1812 (s. o.).
Ein in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. von Ernst Friedländer erstelltes Repertorium enthält neben den Dokumenten, die heute dem Aktenbestand des Clerus secundarius zugeordnet sind, auch den Hinweis auf mehrere Urkunden, die wahrscheinlich entweder in einem Konvolut zusammengefasst oder in den Akten eingebunden waren. Laut einem Nachtrag in diesem Repertorium ist ein Konvolut von Urkunden dem Allgemeinen Urkundenbestand entnommen worden (Laufzeit: 1429ff.) und dem Mischbestand Clerus secundarius hinzugefügt worden, was die divergierenden Provenienzen und Inhalte des Urkundenbestandes erklärt (s. u.). Im Jahr 1983, als Peter Veddeler den Aktenbestand Clerus secundarius verzeichnete (A 119), entnahm er ihm die darin befindlichen Urkunden, um sie zu einem eigenen Bestand zu formieren.
Die Zahl der überlieferten Urkunden beträgt 46, ihr Überlieferungszeitraum erstreckt sich von 1429 bis 1777. Rechtsgegenstand und Provenienz der Urkunden sind entsprechend der Bestandsgeschichte und der Zusammensetzung des Sekundarklerus sehr disparat. So finden sich neben zahlreichen Streitsachen (18) und Rentengeschäften (11) auch Grundstücksverkäufe bzw. -käufe (6), Freibriefe (4), Stiftungen (3) sowie drei Provisionen auf Vikarien und eine Urkunde betreffend ein Subsidium charitativum des Sekundarklerus. Lediglich in 12 Fällen (Urkunden Nr. 5-13, 21, 23 und 30) ist ein konkreter Bezug zur Union des Clerus secundarius erkennbar, wobei die Inhalte der Urkunden neben einem Rentengeschäft und dem Subsidium charitativum ausschließlich gerichtliche Auseinandersetzungen betreffen. Bei allen übrigen Urkunden haben zwar stets Geistliche oder kirchliche Institutionen (z. B. Kollegiatstifte, Pfarrkirchen oder Geistliche des Bistums Münster), die zum Sekundarklerus gehörten, mitgewirkt, ein Zusammenhang zwischen dem Verhandlungsgegenstand und der Gemeinschaft des Clerus secundarius ist jedoch nicht erkennbar. Deutlich wird das v. a. bei den elf Rentengeschäften, von denen zehn keinen direkten Bezug zum Sekundarklerus haben, was die Vermutung nahe legt, dass sie nicht dem originären Archiv des Clerus secundarius entstammen, sondern zu denjenigen Urkunden gehören, die dem "Allgemeinen Urkundenbestand" entnommen worden sind. Gleichwohl verfügte die Gemeinschaft des Sekundarklerus über ein eigenes Vermögen und hat (auch gemeinsam mit dem Clerus primarius) Geld verliehen, bzw. Renten gekauft. Abschriften der darüber ausgestellten Urkunden finden sich in dem Manuskript Clerus secundarius Akten, Nr. 2, wobei lediglich eine der dort aufgeführten Urkunden als Original im vorliegenden Bestand existiert. Es handelt sich um die Urkunde Nr. 30, in welcher der Clerus secundarius auch ausdrücklich als Gläubiger genannt wird. Es ist anzunehmen, dass ursprünglich auch die übrigen Urkundenabschriften als Originale im Archiv des Sekundarklerus vorhanden waren.
Über die Auflösung des Clerus secundarius gibt es ebenso wenig schriftliche Nachrichten wie über seine Formierung. Das Ende der Gemeinschaft ist in der Zeit um 1810 anzusiedeln, als durch die Säkularisation ein Großteil seiner Mitglieder weggefallen ist. Wenngleich es auch in anderen Bistümern (Köln, Paderborn, Osnabrück, Hildesheim, Mainz) vergleichbare Klerikervereinigungen gegeben hat, so hat sich dies lediglich im historischen Archiv der Stadt Köln in der Bildung eines Bestandes Clerus secundarius (Best.-Nr. 290) niedergeschlagen.
Die in den 46 Urkunden des Bestandes begegnenden Personen- und Ortsnamen wurden in einem Register zusammengeführt und anhand von Hilfsmitteln - z. B. Weiheregister des Bistums Münster (Kohl 1991/1999), Notariatsmatrikel des Fürstbistums (Geistliches Hofgericht, Notariatsmatrikel Nr. 1 u. 2 sowie Kohl 1962 und Ketteler 1962) - vereinheitlicht.
Der Bestand wurde im August 2009 von Thorsten Unger, Michael Ruprecht, Karoline Riener und Thomas Notthoff im Rahmen des Referendariats am Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen verzeichnet. |
|

 Münster, zum
Münster, zum  Fürstbistum Münster und zu
Fürstbistum Münster und zu  Klöstern und Stiften in Münster im Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
Klöstern und Stiften in Münster im Internet-Portal "Westfälische Geschichte" Dom zu Münster | Google Maps
Dom zu Münster | Google Maps  zurück
zurück


 Urkunden
Urkunden
 Franz von Waldeck
Franz von Waldeck