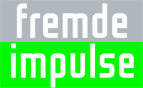Organisches Bauen
Nach seinen Idealen des organhaften Bauens wollte Hans Scharoun die Architektur der Schulen konsequent für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen planen, die hier lernen und sich heimisch fühlen sollten.
© Sammlung Hans-Jürgen Korn, Lünen
Kunst zurück zur Auswahl
Der Beginn des organischen Bauens im Ruhrgebiet
Das hatte es bisher noch nicht gegeben: Schulen mit Klassen-„Wohnungen“, in denen sich die Schülerinnen und Schüler heimisch fühlen sollten, und die sich an ihrem Alter orientierten. Nach seinen Idealen des organhaften Bauens wollte Hans Scharoun die Architektur der Schulen konsequent für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen planen, die hier lernen sollten. Im westfälischen Lünen im nördlichen Ruhrgebiet konnte der Architekt 1956 seine Ideen für eine humane Schularchitektur erstmals realisieren. Scharouns Schule in Lünen zählte zu den ungewöhnlichsten ihrer Zeit in der ganzen Bundesrepublik und ist bis heute Vorbild für innovative Schulbauten.
1960-1968 folgte dann eine weitere von ihm konzipierte Schule: Auch in Marl wollte man für die Schüler einen Schulbau, der sich demonstrativ von den alten Kasernenschulen mit ihren einschüchternden Portalen und langen Gängen absetzte. In dem neu entstandenen Stadtteil Drewer realisierte Scharoun eine Volksschule nach seinen Idealen. Zentrum dieses Entwurfs ist die nach dem Vorbild der Berliner Philharmonie errichtete Aula. Sie rückte Scharoun in die Mitte der Schule und gruppierte die Klassen- und Fachräume darum herum.
Erstmals hatte Scharoun 1951 beim Darmstädter Gespräch „Mensch und Raum“ eine völlig neu konzipierte Volksschule vorgestellt und damit heftige Diskussionen ausgelöst. In Darmstadt erörterten Philosophen und Architekten Fragen zur zeitgenössischen Architektur. Hier stellten Architekten elf Projekte zum Wiederaufbau der Stadt Darmstadt vor, von denen fünf als "Meisterbauten" zwischen 1954 und 1960 verwirklicht wurden.
In seinem Darmstädter Entwurf entwickelte Scharoun drei Klassentypen. Für die jüngsten Kinder schuf er nestartige Strukturen mit Höhlencharakter. Für die Kinder mittleren Alters sah er abgeschlossene Einheiten mit Rückzugsmöglichkeiten vor und für die ältesten Schüler Räume, in denen sie das neu erworbene Selbstbewusstsein entfalten und erproben konnten. Diese Klassen bildeten dann als „Organe“ zusammen mit der als „Weg der Begegnung“ konzipierten Pausenhalle einen komplex gegliederten Schul-Körper, der von Innen nach Außen entwickelt war, gleichzeitig aber auch die umgebende Landschaft mit einbezog.
Mit diesen differenzierten Einheiten entstanden einerseits kleinere Räume oder Rückzugsmöglichkeiten für verschieden große Gruppen, andererseits Räumlichkeiten für das lockere Zusammenkommen größerer Gemeinschaften oder der gesamten Schulschaft.
In Anlehnung an die Architekturtheorie Hugo Härings sprach Scharoun von organhafter Architektur, die sich an den Gestaltungsprinzipien der Natur orientiere. Scharoun ging es jedoch nicht darum, Erscheinungsformen des Organischen in der Natur wie zum Beispiel Bienenwaben nachzuahmen. „Die Gestalt der Schule will organhaft das Wesen des Schullebens spiegeln. Deshalb kann unser Ordnungsgefüge nicht additiven Prinzips sein. Die Reihung auch noch so gut technisch-funktionell gelöster Einzelräume genügt nicht. Es sind vielmehr die Schulteile Glieder eines Ganzen und sie wirken zusammen wie Organe im Organismus und Organismen in der Ganzheit zusammenwirken.“ In dieser Vielschichtigkeit seiner Architektur sah Scharoun Parallelen zur kubistischen Malerei von Pablo Picasso (1881-1973) und Georges Braque (1862-1963).
Sein Kollege Paul Bonatz verriss diese komplex differenzierte Architektur, die sich konsequent nach Alter und Bedürfnissen der Kinder richtete und führte sie als ein Beispiel des „Zerdenkens“ an.
Der Begriff „organische Architektur“ fasst Architekturrichtungen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zusammen, bei denen Gebäude und Landschaft harmonisch aufeinander abgestimmt sein sollen. Insbesondere werden „organisch“ aus der Funktion heraus entwickelte Formen bevorzugt, um eine sozial, psychologisch und biologisch zweckmäßige Architektur zu erreichen. Dieser Ansatz entstand im Zuge der Befreiung von historisierenden Architekturstilen und –formen. Wichtige Vertreter der ersten Generation waren Antoni Gaudi, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright.
Denkmale zum Impuls
Lünen - Städtisches Geschwister-Scholl-Gymnasium
»Mensch und Raum« hieß 1951 das Thema der Darmstädter Gespräche ... weiter
Marl - Scharoun-Schule in Drewer
Musikliebhaber in aller Welt wissen die spektakuläre Raumform der Berliner Philharmonie mit ... weiter