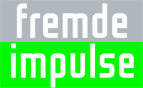Für den Architekten des Musiktheaters in Gelsenkirchen, Werner Ruhnau, war die Vereinigung von Architektur, Malerei und Plastik ein wichtiges Anliegen. Die am und im Musiktheater zu sehenden Kunstwerke von Yves Klein, Paul Dierkes und Norbert Kricke gehen auf seine persönlichen Kontakte und Vorschläge zurück.
© Foto Hermann Willers
Kunst zurück zur Auswahl
Experimentelle Architektur und innovative Wohnideen
Besucht man die Städte Marl, Castrop-Rauxel, Essen oder Recklinghausen, so ist ein unvorbereiteter Betrachter überrascht von der Fremdartigkeit der vor ihm erscheinenden Gebäudekomplexe – wegen ihrer Dimension und Baugestalt und wegen ihres architektonischen Ausdrucks. Die im Folgenden vorgestellten Bauten sind heute für uns bemerkenswerte Zeugen von Aufbruch und Freude am Neuartigen in den Wirtschaftswunderjahren der Bundesrepublik Deutschland.
In den ambitionierten, ohne Rücksichtnahme auf vorhandene städtebauliche Strukturen errichteten kommunalen Neubauten von Marl und Castrop-Rauxel manifestiert sich nicht nur ein seinerzeit modernes Architekturverständnis, sondern auch der Wille, den von hier verwalteten Städten einen neuen urbanen, kulturellen Mittelpunkt und ein neues Selbstverständnis zu geben. Wirtschaftswachstum und Bevölkerungszunahme erlaubten neue, bis dahin ungeahnte Möglichkeiten und visionäre Vorstellungen. Herrschte bis in die zweite Hälfte der 1950er Jahre ein eher konservativer Zeitgeist, so ist dem in den folgenden Jahren mit unkonventionellen Bauten wie in Marl und Castrop-Rauxel ein frischer, mutiger Anspruch entgegengesetzt worden.
Für die Realisierung der ehrgeizigen Projekte wurden ausgewählte, international renommierte Büros zu beschränkten Wettbewerben eingeladen. So wurde der neue Rathauskomplex in Castrop-Rauxel mit Stadthalle und Vierfach-Turnhalle nach Plänen der Dänen Arne Jacobsen und Otto Weitling realisiert, die aus der Konkurrenz 1966 als Sieger hervorgegangen waren. Entstanden ist eine ausgedehnte Gebäudegruppe aus langgestreckten Riegelbauten, denen drei unterschiedlich große Saal- und Hallenbauten mit leichten Hängedachkonstruktionen vorgelagert sind. Vergleichbares war bislang in der Region nicht gebaut worden.
Für die neue Zeit hat auch Marl ein neues Rathaus als Stadtmittelpunkt errichtet, das zugleich ein neues urbanes Stadtzentrum sein sollte. Die niederländischen Architekten Johannes Hendrik van den Broek und Jacob Berend Bakema realisierten 1960-67 die Marler Rathaustürme als Hängehochhäuser – die ersten ihrer Art in der Bundesrepublik. Die Marler Rathaustürme zeugen wie die über 60 Meter frei gespannte, als Ratstrakt errichtete Stahlbetonhalle mit ihrem auffälligen Faltdach vom Willen zur Modernität und vom mutigen Zukunftsoptimismus der Zeit.
Dies gilt auch für weitere Bauten in der unmittelbaren Nachbarschaft, etwa für den sogenannten Wohnhügel der Stuttgarter Architekten Peter Faller, Fritz Frey und Herrmann Schröder, einem bis dahin ungebauten Haustyp, bei dem die Grundfläche nach oben hin abnimmt und die Wohngeschosse zurücktreten.
Ein anderer Impulse manifestiert sich in den kulturelle Neubauten, die in der 1950-60er Jahren im Ruhrgebiet entstanden. In Gelsenkirchen wurde 1959 das neue Musiktheater mit einer Innengestaltung von Yves Klein eröffnet. Es handelt sich beim „Großen Haus“ um einen kubischen Baukörper, dessen Wände nahezu nur aus Glas bestehen. Das Erdgeschoss ist unter dem aufsteigenden Glaskubus nach innen gezogen, sodass dieser zu schweben scheint. Die großzügigen Glasfassaden verbinden das urbane Geschehen außen mit der Faszination der Bühne innen.
Der Franzose Yves Klein (1928-1962) gestaltete mit seinen großflächigen Reliefs das Foyer des Theaters. Das intensive Ultramarinblau der übergroßen Farbflächen, das in seiner chemischen Zusammensetzung zum speziellen „Gelsenkirchener Blau“ neu entwickelt wurde, erzielt eine enorme Tiefenwirkung, die durch die plastische Wirkung der aufmontierten Naturschwämme verstärkt wird.
Neben den damals fremdartig wirkenden Arbeiten von Paul Dierkes und Norbert Kricke sind es vor allem diese Kunstwerke des französischen Künstlers, die bis heute den Mut und Gestaltungswillen der Erbauungszeit demonstrieren.
Für den Architekten des Musiktheaters in Gelsenkirchen, Werner Ruhnau, war die Vereinigung von Architektur, Malerei und Plastik ein wichtiges Anliegen. Die am und im Musiktheater zu sehenden Kunstwerke gehen auf seine persönlichen Kontakte und Vorschläge zurück.
Diesen Wunsch nach der Verbindung von Architektur und Plastik illustriert auch das Festspielhaus in Recklinghausen. Der englische Künstler Henry Moore (1898-1986) ist bekannt für seine großen, abstrakten Skulpturen, die meist Frauenfiguren, teils auch Familiengruppen darstellen. Die Skulptur „Two Piece Reclining Figure No. 5“, von den Bürgern „Große Liegende” genannt, schuf Henry Moore 1963/64. Sie wurde vor dem Haupteingang des Festspielhauses in Recklinghausen aufgestellt, was Moore 1965 selbst überwachte. Das Theatergebäude wurde 1998/99 gänzlich umgestalte, sodass man auch die Skulptur in einen neuen Kontext und in eine neu geschaffenen Vorplatzsituation einband. Die „Große Liegende“ ist nun in das harmonische Gesamtbild als Mittler zwischen Theatervorplatz und Grünanlage des Stadtparks integriert und besteht doch als autonomes Kunstwerk.
Ein weiteres Beispiel ist das Aalto-Theater in Essen, das die genannten Impulse, den Mut ausländischer Architekten und die Verbindung von Architektur und Skulptur, in sich vereint. Das Gebäude zeichnet sich durch die spezielle Architektur des Finnen Alvar Aalto aus: das „organische Bauen“. Aaltos Formen sind mit Begriffen aus der Geometrie kaum zu beschreiben – im Vergleich mit den geradlinigen Bauten der unmittelbaren Umgebung erscheint das Opernhaus in Essen eher als »gewachsen« denn als »gebaut«. Hinter der asymmetrisch gewellten Eingangswand öffnet sich das hohe, lichtdurchflutete Foyer mit offenen Besuchertreppen. Das Auditorium ist wiederum asymmetrisch gestaltet, mit geschwungenen Balkonen vor der gewellten Saalrückwand. Ein tiefes Indigoblau im Zusammenspiel mit Weiß dominiert die farbliche Gestaltung des Innenraums.
Denkmale zum Impuls
Gelsenkirchen - Musiktheater im Revier
Das Gelsenkirchener Musiktheater zählt zu den herausragenden modernen Theaterbauten in ... weiter
Essen - Aalto-Theater
In Essen entstand in den 1950er Jahren die Idee, Sprechtheater und Musiktheater zu trennen. 1955 ... weiter
Castrop-Rauxel - Forum und Rathaus
In Castrop-Rauxel sollte ein neuer Stadtmittelpunkt entstehen, mit einem Rathaus, das ... weiter
Marl - Wohnhügelhaus
In den 1950er Jahren nahm die Bevölkerung in Marl rasant zu und man benötigte dringend ... weiter
Marl - Rathaus
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs nahm die Bevölkerung der Stadt Marl stark zu, sodass man ... weiter
Recklinghausen - Henry Moore, »Two Piece Reclining Figure No. 5«
1961 wurde zum ersten Mal ein Werk von Henry Moore in Berlin aufgestellt, eine ... weiter