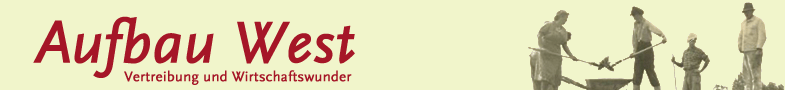Beginn des Inhalts/Link zum Seitenanfang| Link zur Seitennavigation|
Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen


Als Erika Steinbach 1998 Präsidentin des BdV wurde und ihre Idee des Zentrums entwickelte, hatte sich das schwierige Verhältnis zwischen Polen und Vertriebenen gerade zu entspannen begonnen. Auslöser war die „Jedwabne-Debatte“, eine Debatte um das von Polen verübte Pogrom an den jüdischen Bewohnern des Dorfes während des Zweiten Weltkrieges. Sie hatte in Polen erstmals das eigene Selbstverständnis als Opfer und Helden in Frage gestellt und dazu angeregt, auch die Vertreibung der Deutschen aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Die Stiftungsgründer des Zentrums nutzten diese Situation, um auch polnische Stellen für eine inhaltliche Mitwirkung am Zentrums-Projekt zu gewinnen, stießen aber auf wenig Resonanz. Die Deutschen aktiv darin zu unterstützen, sich nicht mehr als Täter, sondern auch, vielleicht sogar vor allem als Opfer wahrzunehmen und sich selbst auch hier als Täter, ging vielen Polen zu weit. Dazu kam die trotz formaler Unabhängigkeit als sehr eng empfundene Verbindung zwischen Zentrum und BdV, die beide von Erika Steinbach geführt wurden.
Der BdV gilt in Polen als Einrichtung, die die deutsch-polnische Grenze nicht anerkennt, niemals Mitgefühl mit den Schicksalen der polnischen Vertriebenen gezeigt habe und mit der Begründung, dass die Eigentumsfrage der Deutschen nicht endgültig geregelt sei, sogar den EU-Beitritt Polens ablehnte. Das Zentrums-Projekt stieß daher in Polen immer wieder auf „leidenschaftlichen, teils gar hysterischen Widerstand“, wie die Süddeutsche Zeitung resümierte, Erika Steinbach wurde im September 2003 gar auf dem Titelblatt des Magazins Wprost mit einer SS-Uniform bekleidet auf Bundeskanzler Gerhard Schröder reitend dargestellt.1
Als Versuch einer erneuten Annäherung schlug der Stiftungs-Vorsitzende Peter Glotz gemeinsam mit den polnischen Publizisten Adam Michnik und Adam Krzeminski vor, das Zentrum gegen Vertreibungen in Wroclaw, dem ehemaligen Breslau, zu errichten. Diesen Vorschlag lehnten jedoch sowohl Erika Steinbach als auch die polnische Regierung ab; die polnischen Medien bezeichneten die beidenPublizisten als Nestbeschmutzer und „bezahlte Einflussagenten Berlins“.2
Von den sich verschlechternden Beziehungen profitierten vor allem die rechten Parteien Polens. Sie machten die Abwehr des Zentrums gegen Vertreibungen zu einem ihrer Wahlkampfschwerpunkte und mobilisierten damit erfolgreich die nationalkonservative und nationalistische Wählerschaft – von Jaroslaw Kaczynski als „nationale Front“ bezeichnet.3 Damit habe Erika Steinbach indirekt die letzten polnischen Wahlen entschieden, stellte die Beauftragte der ehemaligen polnischen Regierung für die Beziehungen zu Deutschland fest.4
Ungehört blieben die vielen liberalen und dialogbereiten Polen, die oftmals die Einrichtung des Zentrums befürworteten. Insbesondere in den ehemaligen deutschen Ostgebieten, wo viele Polen direkte Kontakte zu deutschen Vertriebenen haben und pro-europäisch eingestellt sind, verbreitete auch die Presse keine scharfen antideutschen und nationalistischen Meinungen. Das Verhältnis zu Deutschland ist hier deutlich gelassener. Für ganz Polen aber gilt, dass vor allem junge Polen zwischen 16 und 29 Jahren ein deutsches Zentrum gegen Vertreibungen durchaus befürworten und für eine gute Idee halten, wie eine Studie des Bonner Hauses der Geschichte 2005 feststellte.5

Die deutsche Kritik am Zentrum gegen Vertreibungen im Kern entzündete sich ebenfalls oft an der Person Erika Steinbachs. Steinbach hatte während des Balkankriegs im Bundestag vor den steigenden Zahlen von Bürgerkriegsflüchtlingen gewarnt, die den Weg nach Deutschland fänden und dabei die Metapher „die Lunte brennt“ benutzt. Diese Äußerung, so viele Kritiker, disqualifiziere sie als Anwältin einer „ungeteilten Humanitas“ und Kämpferin gegen Flüchtlingselend. Wenn der BdV heute den Europabezug des Zentrums herausstelle, so sei dies bloßer Schein zur eigenen künftigen Existenzsicherung. Die Trennung der Vertreibungen von ihren geschichtlichen Ursachen konstruiere außerdem, wie die Bombenkriegsdebatte zuvor, einen neuen nationalistischen Opfermythos. Joachim Käppner schreibt dazu in der Süddeutschen Zeitung: „Die Crux der Vertriebenenverbände ist eben, dass sie, erstarrt in gesellschaftlicher Isolation, in Leid und falschen Hoffnungen, über Jahrzehnte nationalkonservative Gesinnungsvereine waren. An diesem Erbe tragen sie bei allem Reformwillen schwer, zu schwer, um federführend ein Zentrum gegen Vertreibungen errichten zu können.“6
Der Journalist und Polen-Experte Thomas Urban hat festgestellt, dass sich viele deutsch-polnische Debatten in einer merkwürdigen Weise „überkreuzen“: Die deutsche Rechte sei meist einer Meinung mit den polnischen Linken und Liberalen, die linken und liberalen Kritiker des Zentrums in Deutschland stimmten in der Regel mit der polnischen Rechten überein. 7 Dies verwundere umso mehr, da deutsche Linke und Liberale sich ansonsten mit der polnischen Rechten wegen ihrer gesellschaftlichen Intoleranz, ihres Antisemitismus und ihrer Fremden- und Homosexuellenfeindlichkeit „nie an einen Tisch setzen“ würden.
Politische Unterstützung erhält das Projekt vor allem von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich wiederholt für ein Zentrum gegen Vertreibungen ausgesprochen hat, und ihrer Partei. Bereits 2002 hatte die CDU das Zentrum in ihr Regierungsprogramm und 2006 Erika Steinbach in den Bundesvorstand aufgenommen. Aber auch in der SPD, die eigentlich das durch die ehemalige rot-grüne Regierung initiierte Konkurrenzprojekt eines „Netzwerks Erinnerung und Solidarität“ unterstützt, finden sich Befürworter. Eine Anzeigenkampagne, in der 220 Sozialdemokraten sich für das Zentrum aussprachen, sollte im November 2006 beweisen, dass es auch nach dem Tod von Peter Glotz in der SPD noch Anhänger des Zentrums gibt.8 Zu den Befürwortern in Deutschland zählen auch der jüdische Historiker Julius H. Schoeps, der Historiker Lothar Gall und der jüdische Journalist Ralph Giordano.
Die Reihe der internationalen Unterstützer führt der Erste Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Jose Ayala Lasso, an. Dazu kommen zahlreiche Historiker, Völkerrechtler, Soziologen, Theologen und Journalisten aus Ungarn, Polen, der Schweiz und Israel. Sie sehen, wie etwa der Osteuropa-Experte Jaroslav Sonka, im geplanten Zentrum nicht zuletzt die Chance, auch die Vertriebenen zu einer neuen Weltsicht zu zwingen.8 Die Einbettung ihrer Schicksale in die allgemeine Debatte um Menschenrechtsverletzungen lasse nun einen Druck entstehen, der sie sensibler für Vertreibungen weltweit machen werde.
Fußnoten
- Süddeutsche Zeitung vom 02.12.2005, Seite 4
- Berliner Republik 12/2006
- am 25.08.2004 bei der Sejmdebatte über Reparationsforderungen
- Berliner Republik 12/2006
- Süddeutsche Zeitung vom 09.11.2005, Seite 13
- Süddeutsche Zeitung vom 02.12.2005, Seite 4
- Berliner Republik 12/2006
- Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29.11.2006
- Tageszeitung vom 08.08.2005, Seite 2